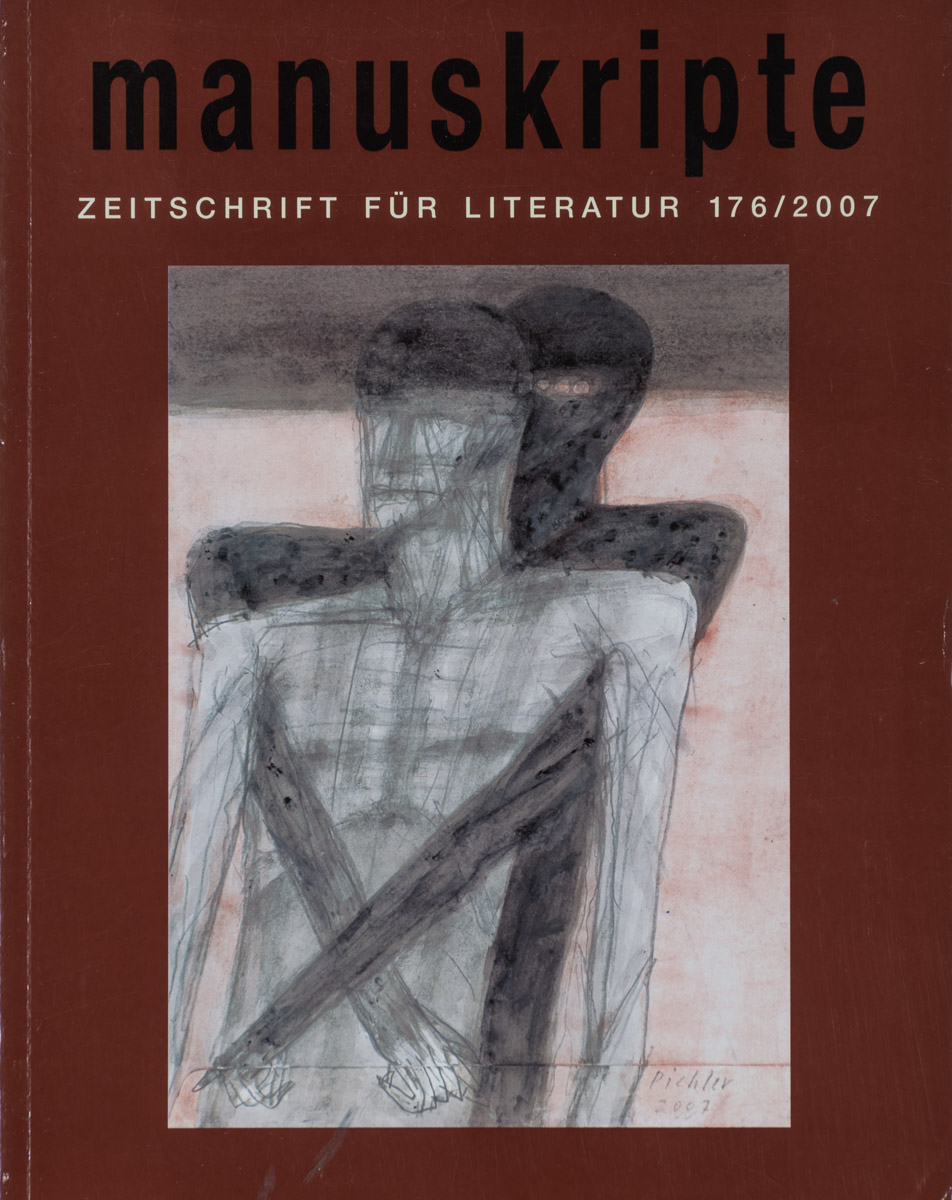Jörg Drews: Laudatio auf Ferdinand Schmatz
Es gibt kaum ein Wort, das ich beim Reden und Schreiben über Literatur oder beim Lesen von über Literatur Geschriebenem so ärgerlich finde wie das Wort „experimentell“ (obwohl das Adjektiv „avantgardistisch“ eigentlich fast genauso schlimm ist), und gleich dahinter kommt die Verwendung des Worts „konkret“ in literaturjournalistischen Zusammenhängen. Ich kriege so ein nervöses Zucken um die Augen herum, wenn ich diese Worte oder Begriffe lese oder höre, denn meistens läuft es darauf hinaus, dass sie eben nicht als trennscharfe Wörter oder als Begriffe benutzt werden, sondern dass sich einer nicht die Mühe gemacht hat, genauer hinzusehen oder im Grunde gleich denunziatorisch vorgehen möchte. Dann sind Ernst Jandl oder Helmut Heißenbüttel „konkrete“ – was der eine ja nur mit einem kleinen Teil seines Werkes ist und der andere fast gar nicht – , und Ferdinand Schmatz zum Beispiel ist in solcher Art Rede natürlich ein „experimenteller“ Autor. Was meist nur heißt: Er macht’s irgendwie anders und halt so, wie man es nicht erwartet hat, und dass es – vor allem sogenannten Inhalt – nehmen wir mal dieses Wort aus dem ebenso hassenswerten Begriffspaar „Form“ und „Inhalt“ – anders ist, merkt der Leser vor allem an der Sprache oder auch an der Erzähltechnik, etwa auch bei Schmatz’ Roman „Portierisch“. Da schiebt sich offenbar was in den Vordergrund, verlangt jedenfalls Aufmerksamkeit, was sonst schier unbewußt irgendwie mitläuft, gar nicht zu bemerken ist; da läßt sich was nicht so leicht anschließen an das, was man glaubt gelernt zu haben … Nun benutzen wir alle ja solche sprachlichen Münzen, solche Behelfswörter, im Bewußtsein ihrer Vorläufigkeit, und vor allem, weil und wenn man oft in der Geschwindigkeit gesprächsweise eine ungefähre Richtung andeuten will, in die eine Sache – sagen wir auch zum Beispiel: ein Text oder eine Argumentation – geht oder liegt, aber ärgerlich wird es dann schon, wenn solch ungeduldiger, im Grunde abwehrender Wortgebrauch sich auch in die kontrollierte, ernsthafte Rede von Literaturkritikern oder Literaturwissenschaftlern einschleicht.
Es hilft aber alles nichts, das Werk von Ferdinand Schmatz wird wohl insgesamt als „experimentell“ verzeichnet, der experimentellen Literatur zugerechnet, und es wird nicht so viel fruchten, tief Atem zu holen und geduldig den Begriff „experimentell“ zu differenzieren, zu destruieren oder, wie man heute oft vornehmer sagt: zu ‚dekonkonstruieren‘, und so, wie wir heute hier versammelt sind, um Ferdinand Schmatz für seine Arbeit zu ehren, braucht es solches Richtigstellen ja eigentlich auch nicht; ich würde da, wie man sagt, zu den Geretteten predigen. Dabei wäre – in kritischen oder wissenschaftlichen zusammenhängen – dem Begriff des Experimentellen ja schon einmal wieder nachzugehen – ob nicht an dem Begriff doch was dran ist, vielleicht gar etwas, das emphatisch zu unterstützen wäre, und zwar in einem anderen als dem höhnischen, denunziatorischen oder auch einfachen konservativen Sinn, in dem Hans Magnus Enzensberger schon Anfang der sechziger Jahre mit den Begriffen „Avantgarde“ und „Experiment“ umsprang. Denn in der Tat benutzt die ‚experimentelle‘ Literatur in jenem Sinn wirklich „experimentell“ Material, Problemstellungen und Sprachanordnungen und treibt sie mit Konsequenz in eine Richtung, die von der allgemeinen Erwartung an Literatur und an Lyrik und an die Verläßlichkeit von Gattungen und Erwartungen abweicht. Aber sie ist eben nicht auf neue Regeln aus, sondern bewegt sich ins Offene, will sich ins Ungesicherte bewegen. Und vor allem ist die immer noch leicht befremdete Rede von der „experimentellen“ Literatur, heute noch angestimmt, deshalb so misslich, weil durch das zwanzigste Jahrhundert hindurch sich schon eine komplette, nicht abreißende und höchst lebendige Tradition von solcher Literatur zieht, und die heutigen „Experimentellen“ haben – mit freudigem Spott gesagt – eigentlich nur die Unverschämtheit, sich auf diese Tradition zu beziehen, daran anzuknüpfen, bestimmte Sprach- und Darstellungsprobleme aufzunehmen, die in dieser Tradition der Literatur so virulent sind wie in der sonstigen Literatur halt andere, weniger radikale, mehr publikumsbezogene, schematischere. Es mag ja übrigens durchaus sein, dass man mit bestimmten konventionelleren literarischen Formen, nämlich zum Beispiel. herkömmlichen Gedichten oder Romanen, bestimmte Aspekte unserer Wirklichkeit durchaus adäquat besprechen und anschaulich machen kann. Daneben aber stellen sich andere Autoren eben andere Fragen, und solche Autoren wie Ferdinand Schmatz sind offenbar bereit, dafür in Kauf zu nehmen, dass sie keine Bestseller verfassen und weniger öffentliche Zustimmung vielfältiger Art bekommen. Aber da gibt es ja dann doch von Einsichtigen berufene Jurys von noch Einsichtigeren, die nicht den Markt entscheiden lassen oder ihn gar zum Qualitätsreferenten machen, sondern dieser Literatur, die hier in Frage steht, ein bisschen näher sind. Außerdem: Seit wann entscheiden auf kulturellem Gebiet irgendwelche Majoritäten über Qualität? Aber Schluß mit der Polemik, und nur noch eine Anmerkung: „Experimentell“ impliziert für viele, dass da eine große Gefahr herrscht, dass da was schief geht, dass etwas eben nur experimentell ist – und der Gegensatz hierzu sei so was wie bewährt, sicher, verlässlich, und trage den Preis davon, den man halt kriegt, wenn man der Devise folgt: Nur keine Experimente. Es ist aber ganz simpel so, dass kein Künstler davor gefeit ist, zu scheitern, und wer kein ‚experimenteller‘ Autor ist, der wird halt anders scheitern, innerhalb seinesRahmens, innerhalb seiner Parameter, als ein sogenannter „experimenteller“ Autor. Langweiliges Zeug gibt es auf sämtlichen Feldern der Literatur genug, unerhebliches, spannungsloses.
Ich bin einen Schritt zurückgetreten und habe mir aus der Distanz angesehen, wie ein Teil der Öffentlichkeit und auch der literarischen Öffentlichkeit über Autoren wie Ferdinand Schmatz redet, wenn sie ihn unter „experimentell“ rubriziert. Eigentlich kann ich darüber aber nur lachen, weil ich selbst die Art, wie die Autoren der Wiener Gruppe etwa, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, auch Franz Josef Czernin und Ferdinand Schmatz, aber zum Beispiel auch – um bei Wiener oder österreichischen Autoren zu bleiben – Oswald Egger oder Michael Donhauser oder Anja Utler schreiben, noch nicht einmal „experimentell“ finde. Ich sehe ihre Art zu schreiben, die ja in sich wieder äußerst vielfältig ist, als das normalste der Welt, als die konsequente, ‚logische‘, gewissermaßen geradezu ‚organische‘ Fortführung dessen, was Schreiben in einem ernsthaften Sinn heute heißen kann. Ferdinand Schmatz überrascht mich zwar immer wieder durch je andere Fortführungen von Schreibweisen, aber dass das je anders aussieht, wundert mich nicht im geringsten. Nehmen wir zwei Nachbarn von Schmatz als Beispiele hinzu: Als thematisch ‚konservative‘ Beispiele, nämlich Anja Utlers Marsyas-Gedichte oder –Texte, und Urs Allemanns Orpheus-Gedicht. Die sind ja – erlauben sie das Paradox – selbst wieder traditionell im Sinne eines erkennbaren kontinuierlichen und hartnäckigen und verantwortungsvollen Bezuges auf Schreibweisen, die nicht umsonst seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind und virulent blieben. Hinter bestimmte Entwicklungen – und zu diesen Entwicklungen gehört auch das heftige Gewahrwerden der aberwitzigen Komplexität des Verhältnisses zwischen Sprache und Welt sowie der Möglichkeiten, aus just dieser Komplexität poetisches Kapital zu schlagen – hinter bestimmte Entwicklungen also bzw. in einen Stand der Entwicklung zurückzufallen, ihn als Autor überhaupt nicht zu beachten, scheint mir kaum möglich; ein solcher wackerer Entschluß, sich den Stand der Unschuld zu erhalten, dürfte in der vollen Konventionalität landen, ja sogar im dem Kenner leicht Komischen. Die deutschsprachige Lyrik der Gegenwart ist, auch wo sie erstaunlicherweise ernsthaft diskutiert wird, ja nicht frei davon Namen zu nennen klänge zu denunziatorisch.
Man hört manchmal bei Lesungen von „experimentellen“ Autoren von Hörern: Also, ich versteh’ nichts, ich hab nichts verstanden – und wenn man bzw. der Autor Glück hat, dann kommt vielleicht noch der Zusatz: aber irgendwie war’s doch faszinierend, oder bezaubernd, oder hinreißend. Zwei Zusätze: Ich gestehe, dass es Lesungen gibt, auch von Autoren, deren Werk man zu kennen glaubt, bei denen man in der Tat zunächst wenig ‚versteht‘, das heißt überfordert ist, die Struktur, die ‚Organisation‘ eines Textes sofort zu verstehen. aber was ich noch viel weniger verstehe, ist, spöttisch bemerkt, bei vielen ‚konventionellen‘, solide konservativen, mit Kühnheiten zu sehr sparsamen Texten, wie ein Mensch heute noch sooo schreiben kann, so hoffnungslos verständlich. Und schließlich: Was man in der Kunst sofort ‚versteht‘, ist ja ohnehin meist nicht wert, verstanden zu werden.
Woher kommt es dann aber, dass bestimmte Texte offenbar eine so viel größere Anstrengung erfordern, um sie hörend lesend verstehend zu – na, sagen wir mal: zu strukturieren? Es hängt wohl mit der tiefsitzenden, uns allen fast zur zweiten Natur gewordenen Erwartung zusammen, dass ein Prosatext erzählt (wenn es nicht gerade ein Essay ist) nach dem Prinzip: und dann und dann und dann, und dass ein Gedicht in einem sprechenden Ich sozusagen zentriert ist. Die Irritation steckt in einem anderen Anschluß, an eine andere Tradition: da ist eventuell nicht die Story als Geländer, und da ist nicht ein lyrisches Ich, auf das sich gesagtes als Erfahrungszentrum für existentielle Befindlichkeiten oder auf Meinungen bezieht bzw. sich bezeihen lässt. Das scheint noch immer schwerstens irritierend zu sein. Aber ein Autor kann ja nicht dauernd aufs Publikum schielen, er dürfte ja sonst nichts Neues machen, und wie soll in einer rapide sich ändernden Welt gerade die Literatur stabil bleiben, stetig und verlässlich? Existentielle Befindlichkeiten oder Erfahrungen aber stellen sich dann doch ein, sind sogar ganz unvermeidlich: Der sogenannte experimentelle Autor ist ja keine unpersönliche Sprach-Kombinations-Maschine, sondern die Findung und Verbindung von Vokabular läßt dann meist ein sehr persönliches Vokabular mit gewissen auch thematisch-motivischen konstanten erkennen, bis zu Affinitäten zu bestimmten Gedichtformen etwa. Man kann das witzig und ernsthaft benannt finden in Ferdinand Schmatz’ „Speise-Gedichten“: „Auf der Jagd nach Stoffen bläst der Schreiber in das Horn der Sprache.“ Oho, groß intoniert, kann man da nur sagen, und aber antworten: „Auf der Jagd nach Sprache stellen sich die Stoffe schon ein.“ In dem Groß-Gedicht oder Sprach-Drama „Die Wolke und die Uhr“ zum Beispiel kann man es ja sogar an der Dynamik des Titels ablesen: man setze zwei Pole, zwei Bilder, zwei Begriffe, man werfe sie wie zwei Steine ins Wasser, sie senden kreisförmig Wellen aus, die Wellen werden sich überschneiden, zwei Wellenfelder werden sich überlappen, ein Autor kann sie poetisch –dynamisch aufeinander beziehen, kann sie aneinander handeln lassen und sie dramatisch agierend Texte generieren lassen. Was herauskommt, ist dann natürlich weder erwartbares Gedicht noch erwartbare Einzelgedichte oder ein Drama, aber dramatisch. Ein paar Ingredienzien, Accessoires, anders gesagt: suggestive Stichwörter genügen: Wolke und Uhr etwa, oder im Falle eines anderen Buches von Schmatz, des Dschungelbuchs, ist es noch eine andere Vokabelgruppe, die auslöst und Kern für den Text ist, und einer sagt dazu: „Weiter sage ich nichts dazu, sondern lese und spreche einfach nach: Flut, Ebbe, Mann, Frau, Palme, Tiger, Platz, Hirsch und Geweih“, und ich selbst füge hinzu: Stamm
bäumt sich
auf eigener achse ring
ahnt im wachsen, das, zurück
verzweigt von unten nachgekommenes
kerben der rinde haut –
oben, dunkel
gründend wurzel für weite
Oder – einer meiner Lieblinge im Dschungelbuch „dschungel allfach“ – ::blatt
nie gepflücktes
entfaltet das unvolle,
durchädert es gewendet –
entblössend den ganzen saft
Was übrigens oft zu kurz kommt auch in verständigen Besprechungen von Büchern der neuen Poesie (noch so ein ungenaues Sammelwort, das man nur retten kann, wenn man es augenzwinkernd emphatisch gebraucht und zugleich darauf hindeutend, dass Ferdinand Schmatz jahrelang dem BIELEFELDER COLLOQUIUM NEUE POESIE angehörte und wir uns natürlich bestätigt fühlen dadurch, dass nicht nur der Büchner-Preisträger Oskar Pastior und die Büchner-Preisträgerin Friederike Mayröcker, sondern auch der H. C. Artmann-Preisträger dieses Jahres etwas mit unserem Colloquium, unserer inzwischen legendären Genie-Truppe zu tun hatten) – was also oft zu kurz kommt, ist der Hinweis, dass gerade auch die Speise-Gedichte von Ferdinand Schmatz heiter und übermütig sind, dass die Ausnutzung von Doppel- und Dreifachbedeutungen von Worten oder Wörtern, die Beistellung von Quasi-Kommentaren, die manchmal selbst fast wieder Prosagedichte sind und manchmal engst benachbart den „Fleicheslust“-Texten von Oskar Pastior, bisweilen auch launig amplifizierende, komisch ungenaue Paraphrasen des jeweils links stehenden Gedichts die schönsten Heiterkeitseffekte produziert. Das muß man doch auch einmal feststellen, wo doch mit verdammt wissenschaftlichem Ernst oder doch quasi-wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit der Autor Schmatz in Kooperation mit einem Kommunikationssoziologen der Tatsache abzuhelfen versuchen mußte, dass die Wissenschaft 50 Jahre hinter dem Stand der experimentellen Poesie herhinkt. Das ist nun eine ein bißchen arg summarische Behauptungen, aber grundsätzlich richtig – siehe Schmatz’ Buch – Dialog mit Herrn Fuchs, und das führt uns natürlich wieder zu der Frage, warum nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern viel mehr noch in der Literaturwissenschaft die Resistenz gegen die experimentellen Schreibweisen noch immer so groß ist, dass die allermeisten Germanistik-Professoren lieber die 583. Dissertation über Thomas Mann schreiben lassen als dass sie mal die unkonventionelleren Schreibweisen des 20. Jahrhunderts genauer untersuchen ließen – was wahrscheinlich nicht nur auf Grund von Unkenntnis so ist. Aber lassen wir das; ich werde nicht ausplaudern, was ich zur Frage der Prädisposition vieler Kollegen zu bestimmten Sorten von Literatur denke. In dem sehr instruktiven, aber irgendwie auch deprimierenden Briefwechsel zwischen Herrn Fuchs und Herrn Schmatz heißt es einmal (es spricht hier der Soziologe Fuchs): Es gebe halt „Annahme oder Ablehnung der Sinnzumutung, die jemand offeriert“ (Sie ahnen, mit „Sinnzumutung“ meint Herr Fuchs hier poetische Texte wie die von Ferdinand Schmatz), und da sei es offenbar bar so, dass „viele andere (…) diese besondere Selektionszumutung ‚Gedicht’ nicht ratifizieren.“ Ja, so kann man es ausdrücken. In Berlin jedenfalls – damals waren wir noch nicht Schmatz-Leser – haben wir das 1968 so skandiert: „Wir. Sind. Eine. Kleine. Radi. Kale. Minder. Heit“, meinten damit allerdings noch was anderes. Und Herr Fuchs fährt fort, bei der Frage, woher die Akzeptanz und Rückendeckung für Stücke experimenteller Poesie denn überhaupt zu holen sei: „… es käme alles auf die soziale Legitimation von Personen an, die – aus welchen kontingenten Gründen auch immer – die Befugnis zur Behauptung haben, ein Text sei ein Gedicht.“ Worauf man nur sagen kann, dass diese Art von „sozialer Legitimation“ nicht mehr zu haben ist, für sie gibt es eine vorgesehene Instanz höchstens noch in vereinzelten juristischen oder verwaltungstechnischen Körperschaften, vielleicht in Jurys, die ein bißchen Freiraum haben, sonst aber? Woher käme denn sonst eine Körperschaft, ein Gremium, die etwa gar per Volksentscheid und Mehrheitsentscheidung diese Legitimation verliehe und ausspräche? Das nehmen wir dann lieber tapfer auf die eigene Kappe, an erster Stelle der Autor, an zweiter Stelle jene verschworene Leserminderheit, die sich nicht ausreden lässt, dass die Texte von Ferdinand Schmatz Gedichte sind, ja, Gedichte, wenn auch nicht an jeder Stelle Lyrik, was macht’s.
Eine Laudatio, behauptete vor kurzem ein kluger Kopf, sei eine „peinliche Gattung“, weil man eben den Laudierten so gar ins Gesicht hinein loben müsse, und weil der Laudator immer auch sich selbst lobe, indirekt, dass und weil er nämlich so schlau ist, die Bedeutung des Laudierten oder der Laudierten erkannt zu haben, usw. Nun, hoffentlich war’s heute abend nicht so peinlich, und mir jedenfalls, sage ich ganz egoistisch, hat das Nachdenken übers Laudieren, diese Laudatio heute Spaß gemacht, weil ich fünf Bücher von Ferdinand Schmatz wieder lesen und eines, nämlich „Tokyo, Echo“ erstmals lesen konnte, mich also sozusagen relativ entspannt herumtreiben konnte in seinem Werken, und wenn ich auch sagen muß, dass mir einige Sachen näher stehen als andere und ich vor allem auch ein Fan von „portierisch“ und dem großen “babel(n)“ bin, während ich beispielsweise Trakl nicht ganz so hoch einschätze wie offenbar Schmatz und dass jetzt die Diskussion überhaupt erst losgehen müsste, weil wir über die Essays von Schmatz noch gar nicht geredet haben – weil das alles zwar so ist, ich mich aber der Bitte des Kulturreferenten entsinne, nicht länger als zwölf Minuten zu sprechen, höre ich jetzt auf, gratuliere Ferdinand Schmatz sehr herzlich und lese am Ende unverschämterweise eines meiner Lieblingsgedichte vor, das zeigt (wenn das überhaupt nötig wäre, aber sei’s drum), wie sinnlich experimentelle Poesie sein kann:
munden
(phonologie)
eingehöhlt vernasen
raumgestimmte teilzungen
naschend
im mitmund luftentweicht
schlussgemündet verzäpfchen
aufgeschnellte rachenengen
labend
in der fasthöttle ruckveröffnet
hauchverfolgt stimmlippen
schall gequellte nachlüfter
schleckend.
auf der hochzunge unrundvorn
tiefverzungt rundhintern
vorngerundete untergaumer
zergehend
auf der hintenrunde hochumzungt
geniessend abgetieft
unter mundneutrumern
lustumstimmt
Jörg Drews, 4.12.2006
Drews, Jörg: Laudatio auf Ferdinand Schmatz In: Manuskripte. – Graz : manuskripte-Literaturverein 47 2007, 176, S. 112–117 (H. C. Artmann-Preis)