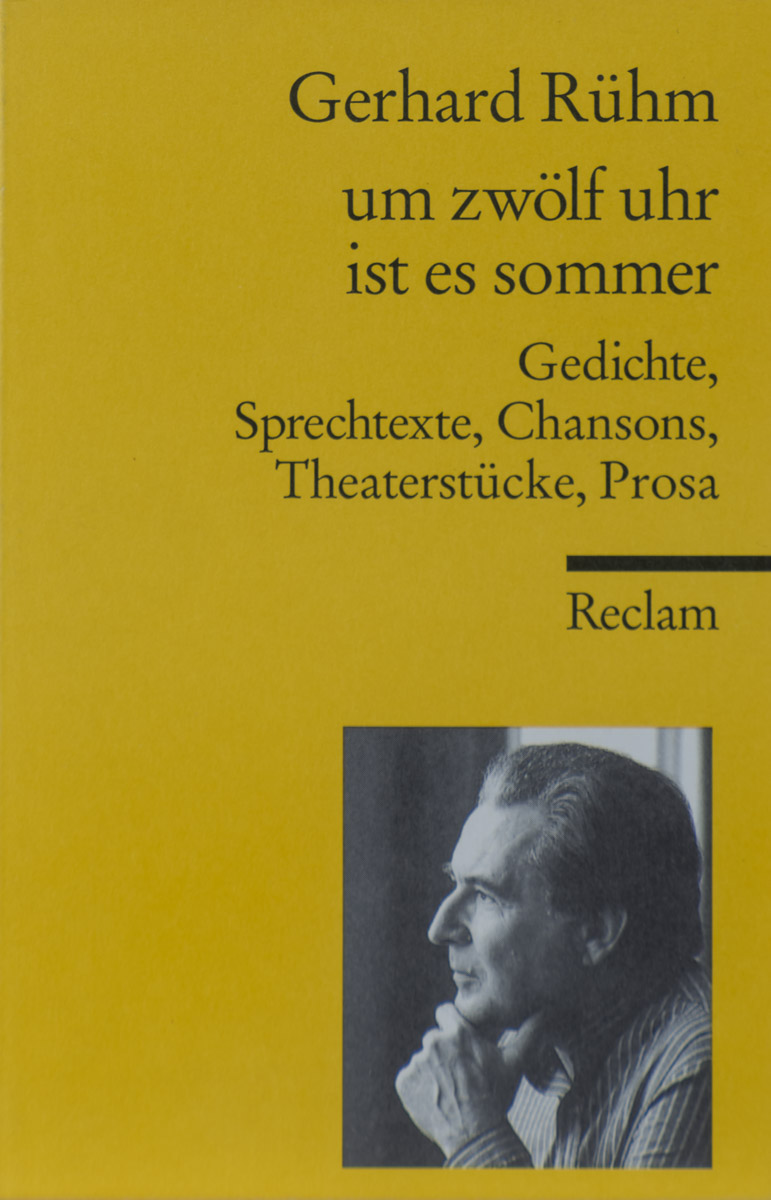Jörg Drews: Nachwort. Zu Gerhard Rühm: um zwölf uhr ist es sommer
Wenn man seit 35 Jahren die künstlerische Produktion Gerhard Rühms verfolgt, wenn man Zeuge der Entfaltung seines dichterischen wie auch zeichnerischen und musikalischen Werks geworden ist, so muß einem eine Auswahl wie die vorliegende fast erheiternd unzulänglich vorkommen. Rühms Produktion hat sich so vielfältig und reich entwickelt und schließt zudem so viele Arbeiten ein, die – anders als die Werke rein literarischer Autoren – sich gar nicht im Taschenbuch darbieten lassen, daß es dem Herausgeber erste Pflicht sein muß, nicht nur sich für eine, seine Auswahl aus diesem Werk zu verantworten, sondern zu umreißen, welche anderen Gebiete künstlerischer Arbeit Rühms die Nachbarschaft zu dieser Auswahl ausmachen. Und extrem ,einseitig‘ muß unsere Auswahl auch deshalb bleiben, weil der Autor nicht nur auch Komponist und Pianist, Zeichner und Collagist ist, sondern auf dem Gebiet seiner im engeren Sinn ,literarischen‘ Arbeiten für die mediale Darstellung seiner Texte auf gewisse Seitenformate und auch Papierqualitäten angewiesen ist bzw. wäre, die ein Taschenbuch nicht bieten kann; obendrein wäre es bei Rühm noch aus einem strengen Grund nötig, ihn akustisch zu Wort kommen zu lassen nicht nur im üblichen Sinn, als einen Vortragenden seines eigenen Werks, sondern weil ein Teil seiner literarischen Arbeiten aus Sprechtexten und Lautgedichten besteht, für die die Wiedergabe im Druck ein noch größerer Behelf ist als die Fixierung von Musik in Noten; musikalische Partituren sind wir gewohnt, literarische Partituren kennen wir in einem genaueren Sinn erst in diesem Jahrhundert, seit es literarische Texte gibt, für die die konkrete akustische Realisation konstituierend und unabdinglich ist.
Diese Schwierigkeiten, eine Auswahl aus Rühms Literatur zu bieten, verweisen natürlich auf ein zentrales Kennzeichen des Werks dieses Autors. Wichtig für seine Arbeit, sagte er 1968, sei seine entschiedene „hinwendung zum materialen aspekt von sprache“. Man muß gleich hinzufügen, daß für sein ganzes Werk gilt, daß das Ausschöpfen bzw. Explorieren des ,Materialen‘, die so spielerische wie systematische Entdeckung dessen, was die Einbeziehung und Reflexion dessen, was ,Material‘ für die künstlerische Arbeit sein und bringen könnte, nicht nur das literarische, sondern auch das musikalische und das bildkünstlerische Werk von Rühm kennzeichnet. Seine Neugierde und seine Interessen wie auch seine Begabung brachten ihn nie in die Situation, die Gunter Falk bei einem der Bielefelder Colloquia Neue Poesie so formulierte:
Machen dürfen wir heute als Künstler alles. Also, was machen wir?
Der unmittelbare schöpferische Antrieb war bei Rühm immer so stark, daß er nie in Gefahr geriet, sich durch theoretisch-reflektierende Skrupel gelähmt zu finden, wobei man aber hinzufügen muß, daß Rühm ähnlich wie alle Autoren der Wiener Gruppe (vielleicht mit Ausnahme H.C. Artmanns) über außerordentliche theoretisch-begriffliche Fähigkeiten verfügt und sein Werk von Anfang an nicht zu denken ist ohne vielfältige denkerische Bemühungen – sprachphilosophische, linguistische, wahrnehmungspsychologische u.a. – um die Ausgangssituation für einen jüngeren Autor, der sich, um 1950 etwa, nicht einfach in die Produktion stürzen will. Stoffe, gesellschaftliche Probleme, ,Anliegen‘, politische Themen etc. waren ihm – obwohl er durchaus auch bestimmte weltanschauliche oder politische Vorlieben und Neigungen hat – kein primärer Schreibantrieb, eher umgekehrt: Formal-sprachliche Aspekte der Literatur interessieren ihn grundsätzlich mehr, dies allerdings mit der Begründung bzw. Unterscheidung, der eigentliche ,Formalismus‘ sei die Benutzung vergleichsweise beliebiger Sprache, Formen, Stile für wechselnde Inhalte, denn damit werde die literarische Form zu einem Gefäß erniedrigt, in das man alles gießen könne.
Um gerade die Anfänge der literarischen Poduktion Gerhard Rühms um 1950 zu verstehen, muß man vor allem darauf verweisen, daß er zunächst stark geprägt war von der neuen Musik und speziell deren Reduzierung des musikalischen Materials auf extrem wenige Bestandteile und Partikel bis zur Beschränkung auf – im äußersten Fall – einen Ton, wie seine „Eintonstücke“ aus den frühen Jahren seiner Komponistenlaufbahn belegen. Er empfand es als Herausforderung, solche Beschränkung auf wenige Elemente auf die Dichtung zu übertragen, etwa in den „einworttafeln“ der frühen fünfziger Jahre, und das kann man vielleicht besser verstehen, wenn man den in Österreich noch viel ungebrochener und traditioneller wieder einsetzenden Literaturbetrieb nach 1945 sich vor Augen hält, der weder den scharfen politischen Bruch und die moralische Katastrophe des Dritten Reichs reflektierte noch auch versuchte, überhaupt sich der Tradition der Avantgarde im 20. Jahrhundert zu versichern.
Der Gestus der frühesten Produktion Gerhard Rühms – und das hat sie mit den Arbeiten von Friedrich Achleitner und Konrad Bayer, von Oswald Wiener und bis zu einem gewissen Grade sogar H.C. Artmann gemein – ist der einer Ablehnung einer stimmungshaft-metaphernseligen Lyrik und überhaupt einer Literatur, die sich bruchlos wieder und weiter der gewohnten literarischen Ausdrucksformen glaubte bedienen zu können. Die Kultur sollte nicht einfach ungebrochen weitergehen; die Autoren der Wiener Gruppe einschließlich Rühms versuchten, könnte man sagen, die Literatur von ihren einzelnen künstlerischen Parametern, von allen ihren Elementen her von innen heraus wieder zusammenzusetzen, das Allgemeine nur insoweit zuzulassen, als es mit einer erneuten Erprobung aller einzelnen Elemente, Kleinteile und Form- und Verknüpfungsschemata der Literatur bzw. Dichtung Hand in Hand ging. Das poetische Bild, der Reim, die ,Handlung‘, die Syntax, die Bedeutung bzw. Bedeutungsvielfalt des einzelnen Worts wurde kritisch beäugt, isoliert, in anderen als den herkömmlichen poetischen Texten zusammengefügt, auch Sätze nach anderen Regeln verknüpft, ,montiert‘. Daraus sollte eine neue Dichtung entstehen, die nicht mit Bilderreichtum prunkt und bedeutsame Geschichten erzählt, sondern die bescheidener und präziser, kühler und durchdachter einen Neuanfang darstellt, der nicht geschwätzig, sondern streng sein und der sich zugleich sowohl auf der Höhe des zeitgenössischen Nachdenkens über die Sprache und Poetik befinden wie auch sich bewußt zur avancierten Kunst und vor allem Literatur der Vergangenheit, insbesondere des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts, verhalten sollte. Für die jungen Autoren hieß dies, sich in den fünfziger Jahren in einer kulturellen Situation, die gekennzeichnet war von der Vernichtung avantgardistischer Texte und der geringen Verfügbarkeit von Informationen über die klassische Moderne vom Expressionismus bis zu Dada und Surrealismus, nach und nach wieder Zugang zu verschaffen zum bereits Vorhandenen, zum Geleisteten. Das war damals mühsam und galt gerade in Österreich für noch abseitiger als in Deutschland, da die radikale Moderne auch nach 1945 zutiefst ungeliebt war, und es war doch auch mit jedem Fund eines Gedichtbandes von Kurt Schwitters, Franz Richard Behrens oder August Stramm oder mit der Lektüre der entsprechenden Abschnitte in Soergels Literaturgeschichte Im Banne des Expressionismus ein geradezu glückhaftes Erlebnis, weil die Autoren der Wiener Gruppe sich bestätigt sehen konnten in den sich herausbildenden eigenen Absichten.
Die Reduktion des (sprach)künstlerischen Materials auf seine Elemente und seine spielerische Neuzusammenfügung zielte einerseits darauf, sich Rechenschaft zu geben über die Konstituenten des ,Poetischen‘ und sich nicht einfach wieder undurchdacht aufs literarisch Ererbte und dessen Wirkung zu verlassen – später kennzeichneten einige der Wiener Experimentellen diese reaktionäre Gesinnung, der sie opponierten, höhnisch mit dem ewig fortzusingenden Zweizeiler „Drum samma froh und heiter / und machen immer weiter!“ –; und anderseits sollte das desavouierte oder überholte ,Wunderbare‘, das Poetische im alten Verstande, neu und emphatisch zeitgenössisch konstituiert werden; Reduktion und Neukonstellierung des Laut-, Wort-, Satz- und Bildmaterials, kurz: eine neue poetische Syntax sollte das Ergebnis der reduktionistischen und montierenden Verfahren sein. Die Vermeidung der Vorhersehbarkeit der konventionalisierten dichterischen Fügung sollte zugleich eine „ausweitung des inneren beziehungsreichtums eines textes“ mit sich bringen, analog zu den Möglichkeiten der Neuorganisation von Abläufen in der Musik nach der Aufhebung der Tonalität. Das klingt abstrakt-konstruktivistisch, doch ist gerade an den „konstellationen und ideogrammen“ gut zu sehen, wie das sparsame, syntaktisch unverbunden nebeneinanderstehende und nur in bestimmten Arrangements auf der Seite plazierte Sprach- bzw. Wortmaterial sich paradoxerweise sehr weiten und vielfältigen Assoziationen öffnet und gerade in seiner Verwandtschaft zur Minimal Art starke Bedeutung und Deutungsmöglichkeiten freigibt; es ergibt sich eine besondere Spannung von kleinteiliger Konkretion und – bisweilen geradezu mystischer – Allgemeinheit und meditativer Unbestimmtheit, die gar nicht so leicht zu analysieren ist. Offensichtlich war bei Rühm von den Buchstabendichtungen der fünfziger Jahre bis zu den melogrammen der achtziger Jahre dies ein starker schöpferischer Reiz, daß „die starke und nach außen dezidiert vertretene reduktionistische Tendenz“ sich zugleich der „unleugbaren Tatsache“ gegenübersah, „dass die Erlebnisse, aber auch manche Kunstwerke eine enorme Wirkung hatten, die der Analyse unzugänglich schien“.
Die konstruktiv gehandhabte Reduktion und die auf das reduzierte Material angewandten Verfahren von Reihung, Montage, visueller Anordnung von Elementen auf der Textseite oder etwa die scheinbare, z.T. mechanistische Erfüllung von Gattungen wie etwa bei den „Fabeln“ oder den „Dokumentarischen Sonetten“ Rühms geben etwas ganz anderes als bloße Reduktion her, nämlich Überraschung, Irritation, Provokation, exotischen Reiz, Verstörung, Verblüffung, kurz: Poesie. Die Verfremdung geschah bei den jungen Autoren der Wiener Gruppe und auch bei Rühm gar nicht so sehr theoriegeleitet, sondern vor allem in der neugierigen Offenheit gegenüber allen neuen Effekten, in der Hoffnung auf eine neue Schönheit und vor allem im Abscheu gegen die konventionelle Absehbarkeit von Sätzen.
Im allgemeinen Verständnis, aber auch z.T. schon in Literaturgeschichten wird Gerhard Rühm oft zur ,Konkreten Poesie‘ oder vager zu ,den Konkreten‘ gezählt. Das ist ein Teil jener terminologischen Ungenauigkeit, die die Bezeichnungen „konkret“, „experimentell“ und „avantgardistisch“ – hinzu kommt manchmal noch die Zusammenstellung „linquistische Poesie“ – durcheinanderwirft, die gewiß zum Teil vorläufig sind und oft auch nur Schlagworte für eine ungefähre Verständigung darstellen, aber doch etwas mehr historische und systematische Trennschärfe besitzen, als offenbar gemeinhin angenommen wird. Gewiß gehört des Werk Gerhard Rühms in jene Tradition des Avantgardismus, welche selbst wieder in diesem Jahrhundert seit etwa 1910 eine Art Konstante in der Literatur geworden ist, und seine künstlerische Haltung ist sicher eine ,experimentelle‘ (er selbst bevorzugt den Begriff „konzeptionell“) in dem eben gekennzeichneten Sinne einer Beobachtung des künstlerisch durch Reduktion neu Möglichen, des durch Material-Bezogenheit allen Arbeitens sich neu Ergebenden. Dabei interessierte Rühm sich wahrscheinlich nicht so tendenziell wissenschaftlich für das Experiment wie der stärker begrifflich ausgerichtete Oswald Wiener, der rückblickend auf die Aktivitäten der Wiener Gruppe in den fünfziger Jahren sagt:
Die Kunst war experimentell, weil die variierte Wirkung auf andere und vor allem auf mich selbst der Gegenstand von Beobachtungen sein konnte, die Hypothesen über die zugrundeliegenden Mechanismen ermöglichen würden.
Rühm ist mehr auf schöpferisches Tun gerichtet als auf Erkenntnis. ,Konkrete Poesie‘ wiederum, und das hat er immer wieder betont, hält er für eine inzwischen abgeschlossene, historische Bewegung, ein Korpus von Texten, die vor allem in den fünfziger Jahren anzusiedeln sind, und nur ein – vergleichsweise geringer – Teil seines eigenen Werks gehört im genauen Sinn zur Konkreten Poesie. Aber ,konkret‘ im Sinne eines Ethos der Bindung ans Material, der Exploration der Möglichkeiten des Materials ist alle Arbeit von Gerhard Rühm. Dafür stehen in unserer vorliegenden Auswahl die „Textbilder“ und – ganz augenfällig – die stark auch visuell wirkenden Beispiele unter den „konstellationen und ideogrammen“, die „sprechtexte“, einige der Theaterstücke und vor allem auch die „wiener lautgedichte“, und eine ,konkrete‘ künstlerische Gesinnung steht z.B. auch hinter den Automatischen Zeichnungen Rühms (von denen wir aus technischen Gründen keine Beispiele hier aufnehmen konnten), in denen er dem Bezug zwischen psychischen Automatismen, der Innervation von gewissen Handbewegungen und ihrem materialen Niederschlag auf der Seite nachgeht, dem Niederschlag psychischer Inhalte bei der Bildgestaltung nachspürt, vermittelt in der Konkretheit dessen, was sich unmittelbar, noch ohne gestaltende, bewußt dirigierende Kontrolle in den den Zeichenstift führenden Handbewegungen eigentlich ereignet und ausformen will: Er versucht, psycho-physische Automatismen als „Steigrohre des Unbewußten“ (Rudolf Tischner) konkret sich niederschlagen zu lassen.
Man muß in diesem Zusammenhang übrigens betonen, daß zum Materialcharakter der Sprache beispielsweise auch gehört, daß bestimmte Wörter historisch belastet und aufgeladen sind: dies gehört zu ihrer Konkretion und bestimmt mit darüber, wie sie eingesetzt werden können, was bei ihrer Lektüre oder ihrem Klang beim Leser/Hörer mitschwingen wird; das deutsche Wort „Wald“ hat ideologische Konnotationen, und bei dem Wort „vergasen“ sieht jeder ein, daß keiner sich darauf zurückziehen könnte, daß dies doch einmal ein ganz unschuldiges Wort gewesen sei.
Im Zusammenhang einer experimentellen Haltung und eines Lauschens auf den konkreten Klang von gesprochener Wiener Mundart in Verbindung mit der Tradition der Lautdichtung von Morgenstern, Paul Scheerbart, Hugo Ball und Kurt Schwitters stehen auch Rühms Wiener Lautgedichte, die nur das extremste Beispiel dafür sind, wie eine Dichtungsart, nämlich die Dialektdichtung – aufgegriffen mit einem neuen künstlerischen Ethos und eingebracht in die moderne Poesie –, ganz neue Möglichkeiten zeigen und – insbesondere auch durch die Gedichte H.C. Artmanns – weittragende Wirkungen auslösen kann; eine fast nur im Heimat-Mief angesiedelte Dichtweise wird ironisch neu geadelt.
Im ganzen deutschen Sprachraum war dies der Anstoß für eine neue, avanciertere Dialektdichtung; an den „wiener lautgedichten“ Rühms aber ist besonders gut die Dialektik von Abstraktheit und Konkretheit zu sehen: Hier ist kein einziges Wort zu verstehen, weil ja vom einzelnen Wort abstrahiert wird, aber daß es sich essentiell um den Wienerischen Tonfall handelt, der konkret, aber asemantisch nachkonstruiert wird, ist sofort erkennbar, insbesondere, wenn man Rühm diese Lautgedichte auch nur einmal hat vortragen hören, Und erheiternd ist dabei geradezu, daß diese „wiener lautgedichte“ in ihrer Machart ja sehr leicht ,erklärbar‘ sind – es handelt sich einfach um eine Anzahl dem Tonfall des Wienerischen sehr ähnlicher kurzer klanglicher Kadenzen mit Verzicht auf Wortbedeutung –, daß aber zugleich bei struktureller und elementarer Einfachheit und einem offenbar sehr kommunikativen Charakter sich bei näherem Zusehen herausstellt, daß die Texte viel komplexer und rätselhafter sind und ihre verblüffende, komische und irritierende Wirkung gar nicht recht zu begründen ist, weil die Produkte psychologisch oder zeichentheoretisch in ziemlich unexplorierte Gebiete hinabreichen: Welche Art von ,Erlebnis‘ vermitteln eigentlich gerade jene Arbeiten Rühms, die ihren Ursprung in Grenzbereichen zwischen höchst bewußter Konstruktivität und psychischer Unwillkürlichkeit haben, wie etwa Schriftzeichnungen, Lautgedichte, Sprachmusiken? Kann etwas außersprachlich gedacht oder wahrgenommen werden, das dann später erinnernd-konstruktiv sprachlich o.ä. ,ausgedrückt‘ wird, oder war da Sprache schon immer beteiligt? Wie verhalten sich verschiedene Arten von Material – bildliches, sprachliches, klanglich-musikalisches – zum Unbewußten, zum Vorbewußten, zum Bewußtsein, und welche verschiedenen Semantiken haben oder entwickeln verschiedene Materialien? Antwort – vorläufig, weil eine in solchen Dingen ja insgesamt noch sehr einfallsarme und konventionelle Literaturwissenschaft dies noch kaum untersucht hat:
Ich glaube, Rühm und die Wiener Gruppe haben sich daran gemacht, diese Problematik in Form einer – als Haltung sich gebenden – poetischen Praxis zu erforschen.
Es dauerte viele Jahre, bis Verlage und eine literarische Öffentlichkeit gefunden waren für die Produkte dieser experimentellen Gesinnung und der poetischen Praxis der Wiener Gruppe, und es dauerte in Österreich noch länger als in Deutschland. Zwar konnte H.C. Artmann 1958 in Wien seinen Gedichtband med ana schwoazzn dintn publizieren, der sogar ein Erfolg wurde, und Rühm konnte 1959 zusammen mit Artmann und mit Friedrich Achleitner in Wien den Band hosn rosn baa (,Hose Rose Knochen‘) veröffentlichen, doch danach dauerte es ein Jahrzehnt, bis wieder eine umfangreichere Publikation Rühms erscheinen konnte, der Band mit Prosa-Texten fenster und die Textsammlung Die Wiener Gruppe. Achleitner Artmann Bayer Rühm Wiener. Texte, Gemeinschaftsarbeiten, Aktionen, der erstmals einen umfangreichen Querschnitt durch die Arbeiten der Wiener Gruppe bot, die spätestens 1964, als Konrad Bayer Selbstmord beging, zu existieren aufhörte. Das heißt, daß die Rezeption der Arbeiten der Wiener Gruppe und Rühms mit einer erheblichen Verspätung einsetzte; eine größere Anzahl Gedichte Rühms erschien überhaupt erst 1970 bei Rowohlt in dem Band gesammelte gedichte und visuelle texte. So wurde auch kaum wahrgenommen, daß Rühm auch auf dem Gebiet der Prosa mit mindestens einem Text entscheidend beteiligt ist an jener bedeutenden Wendung, welche insbesondere die deutschsprachige erzählende Prosa zwischen 1958 und 1962 nahm, beginnend mit Rühms „die frösche“ (1958) und endend mit Alexander Kluges Lebensläufen von 1962; zu dieser Gruppe von Werken gehören auch Peter Weiss’ Der Schatten des Körpers des Kutschers (1960) und Arno Schmidts Roman Kaff auch Mare Crisium (ebenfalls 1960).
„die frösche“ erschien 1968 in fenster, danach 1971 nochmals in dem Taschenbuch die frösche und andere texte und zählt neben „das fenster“ und „textall. ein utopischer roman“ (1993) zu den radikalsten Prosatexten Rühms; er durfte daher in der vorliegenden Auswahl nicht fehlen. Der Text beginnt mit einer sehr ,ordentlichen‘ Orts- und Zeitangabe und schwenkt dann auf eine ganz strikte Innenperspektive des Erzählens, wird zum Inneren Monolog, in dem Synchronizität von Erleben und Wiedergabe simuliert wird, als werde unmittelbar aus dem Bewußtseinsstrom stenographiert. Natürlich muß da nach kurzer Zeit die Frage der Adäquanz von Sprache und Bewußtsein auftauchen, die Frage der Angemessenheit dessen, was dem Vor-sich-hin-Denkenden durch den Kopf geht, zu einem Text, der ja zugleich auch eben diese Erzähl- und Bewußtseinssprache reflektiert und Passagen in den Text einbaut, die er in dem angeblich ,dargestellten‘ Moment, nämlich einem Gang durch das Schilfgebiet am Mörbischer See an einem Sommerabend, kaum gehabt haben kann. Der Text ist der Versuch, sich gewissermaßen total mimetisch zu diesem Gang durch das Schilfgebiet zum Theater zu verhalten, ,mitzukommen‘ bei der Fülle des Gesehenen und Gedachten, mit demselben Tempo es wiederzugeben. Er landet aber eher bei der Frage, wieviel Genauigkeit hilfreich ist und wann absolute Detailgenauigkeit verwirrend wird beim Vorstellen eines Gegenstandes oder einer Szene, auch, welche feinen gedanklich-psychischen Regungen am Rande des Bewußtseins überhaupt noch einzukomponieren sind, wie sich die Vielschichtigkeit von Wahrnehmungs- und Bewußtseinsvorgängen überhaupt linear-sukzessiv darstellen läßt und wieviel Selektion und Stilisierung da unterlaufen muß, auch wenn man als (Mit-)Schreibender noch so naturalistisch-mimetisch sich abmühen will.
Der Text entpuppt sich als eine Fiktion, ohnehin: beim fortlaufenden Gehen kann kein Mensch Notizen machen; also handelt es sich hier nicht um ein Bewußtseinsstenogramm, sondern um Fiktion, die Unmittelbarkeit simuliert, und wenn es in dem Text „jetzt“ heißt, dann ist das wann: innerhalb der Fiktion oder bei der Niederschrift oder beim Lesen des Textes, bei dem ein behauptetes ,jetzt‘ des Textes überhaupt erst zu einem realen ,jetzt‘ wird? Peter Waterhouse hat einmal witzig darauf hingewiesen, daß der Titel von Adalbert Stifters Erzählung Der beschriebene Tännling auch so gelesen werden kann, daß jeder in der Literatur vorkommende Tännling ein „beschriebener“ Tännling ist, nur eben kein wirklicher, sondern ein allein in der Sprache existierender. So daß bei Rühm der Gang durch das Schilfgebiet mit den Fröschen, die so zahlreich und so schlüpfrig den Weg des Gehenden/Schreibenden kreuzen und unsicher machen wie die Wörter, deren er sich bedienen will und muß, ,eigentlich‘ ein Gang in die Sprache ist, in der man sich gegen vieles Andrängende abdichten muß, wenn man überhaupt auf einigermaßen sicherem Grund bleiben will – wie der erzählend-reflektierend Gehende, der auch nur auf der schmalen Straße sicher ist, während rechts und links ungestalt-nichtgestaltbarer Sumpf liegt… Ein Abendspaziergang wird ein Gang durch ein Problemfeld, wird ein – didaktisch gesprochen: – Unterrichtsgang, der damit endet, daß die unfreiwillige Erinnerung sich nicht dagegen wehren kann, daß ein belangloser Satz derjenige ist, welcher am intensivsten hängen bleibt:
i hob den klan teppich ins klawiazimma glegt i hob den klan teppich ins klawiazimma glegt…
Eine Erzählung also in Form eines Inneren Monologs unter Einschluß von Elementen des Nachdenkens darüber, was geschieht, wenn erinnert, aufgezeichnet oder fingiert wird: im Bewußtsein, in der Sprache. Oder andersherum: Die „frösche“ sind ein Essay über ein sprachliches, ein poetologisches Problem, der aber nicht über und von etwas spricht, sondern es konkret vorführt, es wahrhaft ,verkörpert‘.
„die frösche“ ist auch der extensivste Beleg, die längste Demonstration zu dem durchgängigen Interesse Gerhard Rühms an der Darstellung bzw. Darstellbarkeit des ,jetzt‘, des Augenblicks in seiner Emphase und Flüchtigkeit, auch zu verfolgen z.B. an dem Textbild „jetzt“, an dem Sprechtext „geschichte“, dem Gedicht „rausch“ und auch dem Sprechtext „12! ein zahlengedicht“. Er versucht immer wieder, an absolute Jetztzeitigkeit heranzukommen, nachdrücklich und ironisch zugleich, weil er weiß, daß unser Zeiterleben so etwas kennt wie ein ,jetzt‘, dies aber zugleich eine Chimäre ist, nur der Schnittpunkt zweier Linien, der Vergangenheit und der Zukunft – und der Schnittpunkt zweier Linien hat per definitionem keine Fläche.
Bei den Literaturhistorikern kehrt die Beteuerung immer wieder, das Neue an der Literatur des 20. Jahrhunderts, jedenfalls soweit sie der Moderne zugehöre, sei, daß sie eine „nicht-mimetische Literatur“ sei. Dies ist diskutabel, wenn man einen aristotelischen Begriff von ,Mimesis‘ zugrunde legt, der besagt, ein Drama zeige „die Nachahmung einer (menschlichen) Handlung“. Das mag hingehen für Bühnenstücke, trifft aber schon kaum noch fürs Erzählen, dessen Inhalt – nämlich Handlungen und Gedanken – ihm ja gar nicht ähnelt, und noch weniger gilt es schon immer vom Roman, es sei denn, dieser „ahme“ das Erzählen (das außerkünstlerische) „nach“. Nicht nur bei den Werken Rühms, sondern bei aller modernen Literatur kommt einem aber vielmehr der Gedanke, es mache gerade die Literatur des 20. Jahrhunderts in einem erweiterten, anderen Sinn überhaupt erst ernst mit der Mimesis und habe daraus grundsätzlich erst ihre Formenvielfalt gewonnen, von der konkreten Darstellung ausbrechenden Wahnsinns, etwa in Franz Jungs Erzählung „Der Fall Gross“, über Kriegsgedichte des – übrigens von Rühm wiederentdeckten und edierten – Franz Richard Behrens, welche die Zeit zwischen dem Abfeuern eines Geschosses bis zu seinem Einschlag und seine Bahn ,nachahmen‘, bis zur Konkreten Poesie Eugen Gomringers, Emmett Williams’, Friedrich Achleitners, Claus Bremers oder Gerhard Rühms, die auch gesehen werden könnten als extreme Varianten des Prinzips Mimesis. Es wäre reizvoll, allen Formen des Mimetischen als einer Grundlage für den Aufbau, den Ablauf, den Umriß von Texten bei Gerhard Rühm, vom grenzenlos Spielerischen bis zum experimentell Ernsthaften nachzugehen. Das Wörtlichnehmen von Redensarten und Ausdrücken wie auch die Benutzung der Analogie als einer Form des mimetischen Verhaltens gegenüber einem solchen Begriff wie z.B. „Kältetod“ in „abhandlung über das weltall“ oder „Ohrwurm“ in „die frösche“, woraus dann wirklich ein Ohrwurm am Ende des Textes wird, und nicht zuletzt auch das geradezu lachhaft genaue, äffende und zugleich abstrahierende Nachbilden des Wiener Dialekts in den wiener lautgedichten wären Beispiele für einen solchen Neuansatz zu Texttypen auf der Basis von Mimesis. Das Gegenstück hierzu sind dann die nicht-konstruktiven, die assoziativ ,inspirierten‘, mit psychischem Material des Autors arbeitenden Texte bzw. Textgenerierungsverfahren, zu beobachten bei den Schriftzeichnungen oder etwa auch bei den „Märchen“ und den „Fabeln“.
Gerhard Rühms eigene Erläuterungen zu seinen Arbeiten, bei Lesungen immer wieder gegeben, gesammelt u.a. in dem Band TEXT – BILD – MUSIK. ein schau- und lesebuch (1984), zeigen einen Autor, der von Anfang an ein sehr präzises Bewußtsein davon hatte, was er tat, und der ebenso wie die anderen Autoren der Wiener Gruppe die künstlerische Arbeit auf ein ganz anderes, in der Wiener Umgebung der frühen fünfziger Jahre absolut erstaunliches Niveau hob. Zugleich aber muß man festhalten, daß seine Arbeiten am Ende deshalb so lebendig sind, weil sie einen enormen Überschuß über die grundlegende oder die theoretisch rechtfertigende oder die Machart erläuternde Rede haben, manchmal einen geradezu übermütigen vitalen Überschuß. Immer wieder werden Kalkül, Kalkulation, Konstruktion bei ihm beschworen, aber das Verbannte, die Stofflichkeit, die Handlung, die Metapher schleichen sich doch irgendwie in sein Werk ein; vielleicht wurde da mit dem Konstruktiven auch etwas in Schach gehalten: das Anarchische, das Ausufernde, das Triebhafte, das Rauschhafte, übrigens auch das Zärtliche. Einige Beispiele aus der Gruppe der „gedichte“ und der „chansons“ aus den nicht mehr ganz so frühen Jahren wären ein Beleg dafür, daß die konstruktivistische Askese hier etwas gelockert wurde, nicht zum Schaden der Texte. Die bei den großen Abende mit den literarischen Cabarets der Wiener Gruppe in den späten fünfziger Jahren in Wien – 6. Dezember 1958 und 14. April 1959 – lassen etwas davon ahnen, wie das Konstruktive der gezielten Provokation sich hier mit dem auch jugendlichen Gefühl paarte, an einem entscheidenden literarischen und lebensgeschichtlichen Durchbruch zu stehen. Und ich denke, daß auch die bei allem Kalkül doch so bedenkenlose, jedenfalls ganz und gar nicht ängstliche Neigung, „die übernommene poetische Form auswuchern und mutieren zu lassen“, etwas mit dieser überbordenden Lust am Verblüffen, der Kreation rätselhafter oder rätselhaft kurzer Genres zu tun hat: Zeitungsmeldungen werden in Sonette gestaucht, minimales Laut-Material wird so hartnäckig ausgequetscht, bis aus einem klaren Ton ein ersticktes Röcheln, aus Kunst Häßlich-Expressives wird („so lange wie möglich“), und in den Mini-Dramen „der ring“ und „bekannt schafft“ explodiert die extreme Reduktion in einer albern totalen Freisetzung von Assoziationen, die zugleich gebremst wird durch die atemberaubende Kargheit der zugrundeliegenden Kalauer; die können auf der Bühne gar nicht realisiert werden, was diese Theaterstücke eher zu Denk-Spielen, zu Concept Art macht, also zu Literatur.
Die Exploration von Paradoxa – so könnte man ein Prinzip fast aller Rühmschen Arbeiten beschreiben: Sprache drängt zur Musik, Musik hat etwas an sich, das sich anhört, als breche sie gleich in Sprache aus; Laute kann man wie musikalische Töne handhaben; Schrift kann man in Zeichnung überführen und „bildmusik“ daraus werden lassen, indem auf Notenblättern notenähnliche Punkte, Striche und Schraffuren aufgetragen werden, die wegen ihres „Ausdrucks“-Gestus dazu reizen, sie zu spielen – aber sie sind doch nur bildlich, äffen nur Noten, wo, wie auf manchen Blättern Rühms, ein melodieähnliches Auf und Ab von Noten sich findet, die aber nur einzelne Buchstaben sind: eine Kunst lockt bei Rühm in die andere hinüber. Grenzen sind dazu da, überschritten zu werden, Einengung wird nicht akzeptiert, die Materialien überschneiden sich, bis „leselieder“ und „visuelle musik“ herauskommen. Und dies sind Paradoxa, ist nicht Willkür, sondern bleibt staunenswert, weil Gerhard Rühm durch Kalkül kontrolliert und adelt, was sonst leer anarchisch wirkte. Vielleicht kommt daher auch Rühms Liebe zu einem zentralen Paradox: daß jenes dürre, graue, neutrale Instrument namens Alphabet den Gipfel der Willkür darstellt und zugleich, wenn es starr eingehalten wird, einer der praktikabelsten Ordnungsfaktoren ist.
Womit wir fast einen Kreis vollendet hätten: Rühm sieht das Material an, und das Material blickt so vielgestaltig zurück, bietet so viele Arbeitsmöglichkeiten an, weil der Blick, der es aufschließt, lebendig, witzig bis zum Kalauerhaften und doch streng bis zum raffinierten Kalkül ist. Rühm stößt grundsätzlich nicht an die Grenzen des literarisch Machbaren oder Sinnvollen, sondern erfährt eine Begrenzung für sein Werk und dessen Rezeption höchstens an der Tatsache, daß die Zahl derer, die Sprache als Material und Konstituens für Literatur, als durchzuspielende Palette von Problemstellungen, als Elemente zu sehen bereit sind, die immer neu zusammenzudenken eine Lust ist, definitiv begrenzt ist. Sprache als irgendwie gepflegt zu handhabendes Vehikel, als simples Instrument, ist einfach die populärere Vorstellung als die, Sprache und alle Parameter und Möglichkeiten literarischen Sprechens als immer neu zur Disposition und zur Konstruktion bereitstehende Konstituentien von literarischer Wirklichkeit zu betrachten. Überblickt man die Geschichte und auch die Rezeptionsgeschichte dessen, was in den letzten fünfzig Jahren experimentelle Literatur hieß und heißt, muß man konstatieren, daß trotz der vermittelnden Bemühungen etwa von Helmut Heissenbüttel und Heinrich Vormweg, Franz Mon, Ludwig Harig oder Karl Riha, solche Literatur einem größeren Publikum plausibel zu machen, der Kampf gegen den ,Inhaltismus‘ also, wie dies Bertolt Brecht genannt hat, viel schwieriger ist, als man dachte. Die Favoriten des literarischen Geschmacks sind sprachlich von so einfacher Massivität, daß man von deren Lesern nur vergleichsweise wenig Interesse für Autoren wie Gerhard Rühm erwarten kann; dies muß man erkennen, ohne zu klagen. Bizarr dabei bleibt, daß Rühm bei Lesungen außerordentlich erfolgreich ist, die kommunikative Kraft seiner Texte hinreißend, der unmittelbare Genuß offensichtlich groß, der lesende Widerhall aber, bis in die Literaturwissenschaft hinein, wesentlich geringer. Was die Literaturkritik und die Literaturwissenschaft angeht, hängt dies sicher auch damit zusammen, daß Rühms Texten, wie schon gesagt, begrifflich schwer beizukommen ist, weil literaturwissenschaftliche Termini herkömmlicher Art bei ihm oft nicht greifen und bei manchen seiner Arbeiten auch Kenntnisse in den Nachbarkünsten Musik und bildende Kunst für präzisere Untersuchungen und Einschätzungen erforderlich wären.
Doch Rühms Werk, und insbesondere das in der vorliegenden Ausgabe besonders berücksichtigte literarische Werk, hat inzwischen klassischen Rang in jener Tradition von Dichtung seit 1945, die das Nachdenken über ihre eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten in ihre Konstituierung immer einbezieht, und es bleibt im übrigen immer noch die Möglichkeit, daß in Zukunft mehr Leser und Hörer dieses so reichgegliederte, dieses auch so außerordentlich heitere Werk noch entdecken werden.
Jörg Drews, Nachwort zu Gerhard Rühm, um zwölf uhr ist es sommer. Gedichte, Sprechtexte, Chansons, Theaterstücke, Prosa. Reclams Universal-Bibliothek, Band 18055, 2000.