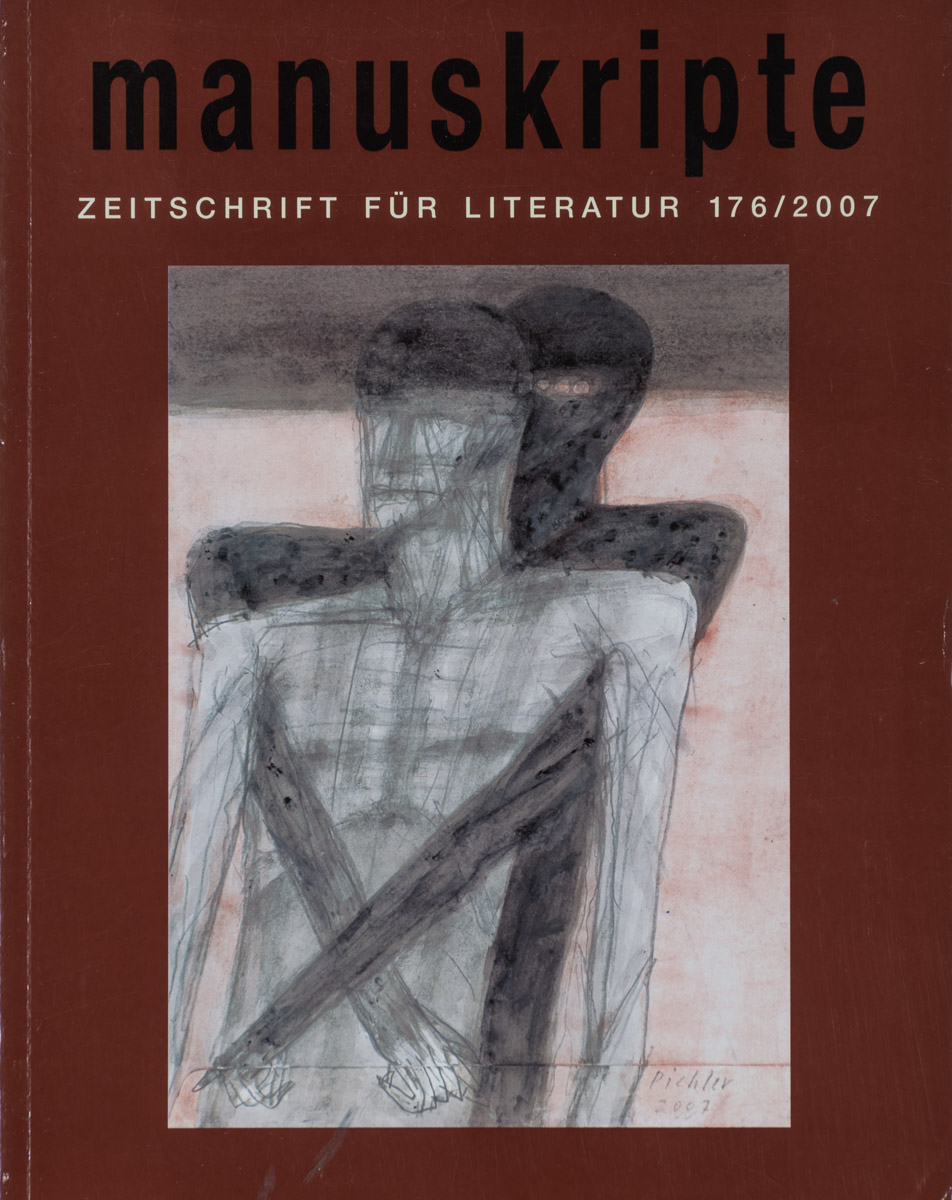Jörg Drews: Über ein Gedicht von Ernst Jandl
Ernst Jandls Gedicht „wien : heldenplatz“ ist bisher dreimal Gegenstand kommentierender bzw. analytischer Bemühungen gewesen. Der Autor hat selbst vom historischen, anekdotisch-persönlichen Hintergrund des Gedichts und dem Umkreis der poetischen Produktion berichtet, in dem das 1962 entstandene Gedicht steht; Peter Pabisch veröffentlichte 1976 den Aufsatz „Sprachliche Struktur und assoziative Thematik in Ernst Jandls experimentellem Gedicht „wien : heldenplatz“, in dem er bestimmte strukturelle Merkmale des Gedichts sowie mögliche Assoziationen zu einzelnen Worten des Texts dingfest machte (dies allerdings bei sehr summarischem und verwirrendem Gebrauch der Termini „konkrete Poesie“, „experimentell“ sowie „Form und Inhalt“) und schließlich war das Gedicht einer der Texte, an denen eine Arbeitsgruppe des Sechsten Internationalen James-Joyce-Symposions 1977 in Dublin der Frage des Einflusses von James Joyce auf die deutsche Literatur nachging. Die Komplexität und zugleich Offenheit des Gedichts und die Bewunderung, die es verdient, reizen mich zu weiterem interpretatorischem Herumprobieren.
„Herumprobieren“, weil das Gedicht zwar einen eindeutig benennbaren ,außerpoetischen‘, historischen Kern, eine lokalisierbare Szene zur Grundlage hat, auf die es sich in einer Schicht narrativ und fast beschreibend bezieht: eine Kundgebung zu Ehren Hitlers nach dem „Anschluß“ Österreichs im Frühjahr 1938, weil es aber zugleich dem Verständnis des einzelnen Worts große Freiheiten bzw. Unsicherheiten eröffnet: die Wortneubildungen, die Bastardierungen von Worten, die ,Hybridisierungen‘ und Mehrfachdeterminierheit vieler Einzelworte legen Assoziationen nahe über deren Stringenz schwieriger zu entscheiden ist als bei den meisten ,konventionellen‘ Gedichten. „das gedicht ist jenseits des entscheidungspaares deutbarkeit-nichtdeutbarkeit angelegt“, schreibt Jandl zu seinem Gedicht „amsterdam“ – das trifft für „wien : heldenplatz“ zwar nicht zu; es ist deutbar, wenn dies heißen soll, daß paraphrasierend rekapitulierbar ist, wovon es handelt und das Verstehen zu einer Art ,Sinn-Ganzem‘ annäherungsweise gelangen kann (die entnervende Unendlichkeit der Möglichkeiten, „deutbar“ und „Verstehen“ zu verstehen, lasse ich mal beiseite), aber die Ingredienzien vieler Einzelworte ihre Provenienz, die Sichtung der Assoziationen, die sie suggerieren, sind unsicher: die Synthese, der Schnittpunkt welchen Wortmaterials der „normalen“ Sprache sind die Worte des Gedichttextes? Kann man das entscheiden? Muß man das entscheiden? Falls Ja und falls nein: warum? Herumprobieren also zum Beispiel an der ersten Zeile „der ganze heldenplatz zirka“. Wird da der „glanze Heldenplatz“ durch die Einschiebung des „l“ sarkiastisch in den „Glanz“ getaucht, den zum Beispiel für die Nazi-Presse die Kundgebungen nach dem Anschluß Österreichs sicher hatten? Wahrscheinlich, doch wie verhält sich das „zirka“ dazu: abschwächend (à la: es war gar nicht der g a n z e Heldenplatz von Menschen erfüllt)? Sollen wir aus „zirka“ auch „Zirkus“ heraushören. Aus despektierliche Kennzeichnung der Kundgebung? Weil die Menge die rednerische Bravourleistungen des Führers bejubelte wie die Darbietungen eines Zauberkünslers? Und sollen wir aus „glanze“ auch „Blüh im Glanze des Glückes“ aus dem Deutschlandlied heraushören? Oder war dessen dritte Strophe damals gar nicht so präsent, daß sie mit Fug assoziierbar ist? „männchenmeere“ jedenfalls setzt die bombastischen „Menschenmeere“ herab, und im Hintergrund von „maschenhaft“ steht sicher „massenhaft“, vielleicht auch „rauschhaft“; aber auch „Masche“ im Sinne von Trick, mit dem Hitler in Kundgebungen und Aufmärschen arbeitete? Und ist es willkürlich, „Maschendraht“ zu assoziieren wegen des Lagerschicksals von KZ-Häftlingen, Flüchtlingen, Kriegsgefangenen? Liest man „versaggerte“ als Kreuzung aus „versacken“ und dem englischen „to sag“, dann wäre dies konsequent innerhalb der peijorativen Kennzeichnung der Atmosphäre der Kundgebung; mit welchem Recht aber fällt mir noch das Verb „sabbern“ ein – könnte man das rechtfertigen im Zusammenhang mit jener Gruppe von Wörtern, die auf körperliche Gier, auf Geifern, auf die Regression der Vernunft aufs Triebhafte hindeuten? Läge dies dann auf der Ebene von „brüllzen“, „feilze“, „-bock“, „balzerig“, „hirscheln“? Das „maskelknie“ schreibt sich wohl von „maskulin“ und „Muskel“ her, das „versuchten“ der vierten Zeile wäre wohl der Versuchung im religiösen und im fleischlichen Sinn zuzuordnen. Ist aber der Versucher der Teufel, so wären die „frauen“, die „sich (!) versuchen“, Teufelinnen, vom Teufel besessen, und hat man nicht auch Hitler dämonologisch als „Teufel“ zu kennzeichnen versucht? Die Frauen wären also brünstig auf den Teufel und schon schwanger von ihm: „dick“ vor Hoffnung auf den Führer, dem alle entgegen-„brüllzen“ – brüllen und balzen deuten dann auf die Geilheit, die in der Begeisterung der Massen steckt, die glauben, jetzt endlich würden sie „wesentlich“. Ist das übrigens auch wieder ein Fingerzeig auf die Sphäre und Atmosphäre pervertierter Religiosität: „Mensch, werde wesentlich“? „brüllzten“, noch einmal: Hat das Wort den gemeinen Beiklang, weil „z“ oder auch die Silbe „ze“ vage was Niederträchtiges, Gemeines suggeriert? Hat nicht August Stramm, den Jandl in seiner Rechenschaft über die Zeit der Entstehung des Gedichts anführt, in dem Gedicht „Erfüllung“ auch mit dem expressiven Wert dieses „ze“ gearbeitet? Hat nicht Arno Schmidt 1953 in Aus dem Leben eines Fauns die Nacht nicht mehr poetisch „die Nacht“, sondern herabsetzend, mit einer Ohrfeige für Romantiker, „die Nachtze“ genannt?
Mittelpunkt der Menge und Mitte des Gedichts ist Hitler, ohne daß er namentlich genannt würde: der Name würde das Phänomen abstrakt erfassen, Hitler soll aber konkret auftreten, und das geschieht mit sprachlichem Gehacktem, mit häßlich hart gefügten, bruchstückhaften Zitaten aus Erscheinungsbild und Sprache Hitlers, die brutal ineinandergestaucht sind. „verwogener stirnscheitelunterschwang“ – ich kann es nicht anders lesen denn als „verwegen“, „verlogen“ und „Woge“, als Konglommerat aus „Scheitel“ und „Stirnlocke“, als „Überschwang“ der Menge („Woge“!) und „Unterschwung“ (eine Turnübung?) (die über die Stirn heruntenhängende Haarsträhne Hitlers?). „nach noten“ und „von Nöten“ sprechend und aus dem Norden, mit Vorstellungen von der „nordischen Rasse“ kommend, „kechelt“ seine Stimme, „hechelt“ und „röchelt“, nimmt an Lautstärke zu, macht Proselyten, macht Menschen zu Nummern, ist „feil“ (wie „billig“) und „geil“ auf Blut und geht aufs Blut, und als ob „feil“ und „geil“ noch nicht genug des Ordinären suggerierten, wird wieder das häßliche „z“ eingefügt – auf daß Worte wie „Fratze“ oder „Rotz“ mitanklingen? „nach nöten“ und „aufs bluten“ haben schon den Tod als Fluchtlinie, in der dann der Tod als Sensenmann, der „sämtliche“ und „jämmerliche“ (aber woher kommt das „t“ in „sämmertliche“?) „eigenwäscher“ dahinmäht. „eigenwäscher“ kommentiert Jandl selbst einfach als „Individualisten“) – warum mußte da das Fremdwort vermieden werden? Damit alle distanzierte Begriffssprache aus dem Gedicht verbannt bleibt? Damit nur „gesundes“, ordinäres Deutsch erklingt? Damit deutltich wird, daß das Kollektiv triumphiert, das alles eigene Denken und Sprechen als „Gewäsch“ im Gebrüll der Menge untergehen läßt?
Wenn mit „brüllzen“ und dem „hecheln“ in „kecheln“ schon das Jagdmotiv eingeführt ist, das Motiv der Menschenjagd, dann wird mit dem Imperativ „pirsch!“ (der zugleich kIingt wie ein einsilbiges Comic-Wort aus einer Sprechblase) die Verfolgung endgültig eröffnet. „von Sa-Atz zu Sa-Atz“ bewegt sich der Bock, der da zum Gärtner gemacht wurde, der aber auch der „Gott“ ist, der angebetet wird, und nicht zu trennen von dem Bier „Doppelbock“ – assoziiere ich das, weil umgekehrt „Sa-Atz“ wie „Sa-Hatz“ klingt und das Lieblingsgetränk bei SA-Versammlungen Bier war? Und ist es legitim zu denken, daß der Gott der Menge auch „Atz“-ung, Nahrung, gab? „Hoppelt“ der Bock, der Herdenanführer, von Satz zu Satz wie Hitlers nachdrückliche, scharf akzentuierende Sprechweise, und ist nicht in dem „döppelte“ auch noch die Möglichkeit des Klanges von „Goebbels“ angelegt? Die Stimme „spreizt“ sich, ist „streng“, klingt zugleich wie „verrenkt“, mimt einen „Hünen“, aber auch einen „Hahn“ und ist eigentlich gar keine tragende, sondern stummelig abgehackte Stimme, die Stummelstimme ist zugleich der Schwanzstummel des Bocks – muß ich so, darf ich so hin- und herspringen zwischen bildlichen und akustischen Vorstellungen, von denen ich annehme, daß sie da zusammengepreßt sind? Die Atmosphäre der verborgen die Menge durchwirkenden sexuellen und Todes-Geilheit kommt an die Oberfläche in „balzerig“: einer balzt in diesem See von „Männekens“ (kann ich so den Berolinismus in den „männechensee“ hineinlesen und ihn als Hinweis auf die Reichshauptstadt Berlin verstehen, auch auf die Sprechweise derer, die in Österreich bisweilen „Piefkes“ genannt werden?), und er balzt stellvertretend für alle, die sich nur noch willenlos-unwillkürlich wie die Würmer krümmen? Die religiöse Bedeutung des Heil-Gebrülls, die pfingstliche Ausgießung des „heil“-igen Geistes, die Brunst der Weiber, denen so ums „Heil“ wird, das sich auf „geil“ reimt und doch ,anständigerweise‘ „Herz“ heißen müßte – hier werden die Bedeutungsstränge zusammengeführt; das tangiert noch den wie betend „knie-enden“, dessen Knie-Ende aber auch wie ein Schwanz wirkt und obendrein in das Geweih des Hirsches hinüberspielt, der ein „Zwölfender“ oder ein „Sechzehnender“ sein kann, ostentativ männlich und zugleich ein längerdienender Unteroffiziersdienstgrad.
Kann man in dem „zumahn“ der letzten Zeile neben „zumal“ auch das Wort „Mahnung“ hören, und hole ich’s zu weit her, wenn mir zum „hünig“ das „Hünengrab“ und „Heldengrab“ der zukünftigen Soldaten einfällt? Das Gedicht ist jedenfalls offen dafür, und so dicht, daß man ihm noch weitere Dichte, also assoziative und klangliche Ingredienzien an jeder Stelle zutraut. Es suggeriert Bedeutung durch gehäufte fragmentarische Andeutung, und es enthält Deutung in dem Sinne, daß Jandl ja nicht nur narrativ oder deskriptiv die Kundgebung zum Thema macht, sondern sie durch Wortwahl und Metaphorik zugleich deutet: als einen Vorgang, der religiöse Verkündung, sexuelle Orgie, Eröffnung der Jagd auf Andersdenkende und Mord- und Selbszerstörungswütige Zusammenrottung in einem ist. Konkrete Entsprechung dieser Vielschichtigkeit ist die als vielschichtige konstruierte Kunstsprache, die die Analyse des Vorgangs vom Sukzessiven ins Simultane rücküberführt. Die Wortbildungstechniken des Expressionismus, vor allem Bechers, Stramms und Ehrensteins, überdies vielleicht Karl Kraus, haben da Pate gestanden. Zur Wirkung des Gedichts gehört sein verhunztes Pathos; „wien : heldenplatz“ vibriert von der inhärenten Spannung der vieldeutigen einzelnen Kunstworte und der durch den Kontext mit VieIdeutigkeit sich aufladenden „normalen“ Wörter, und die Spannung liegt zugleich im Verhältnis der intakten Syntax und den wie beschädigten Worten. Und voller Spannung ist schließlich der Ingrimm, mit dem Jandl sich in die Stimmung der Demonstration von 1938 hineinversetzt und doch die Distanz dazu einbaut.
Vielleicht liegt die gräßlichste Ironie des Gedichts aber darin, daß es sich der sprachlich-poetischen Mittel eben derer bedient, die der Nationalsozialismus als „Formalisten“, „Entartete“ und „Kulturbolschewisten“ aus der deutschen Literatur entfernen, „ausmerzen“ wollte, was ihm ja auch fast gelang. Das Gedicht notiert unter anderem die Tatsache, daß die poetischen Errungenschaften der Otto Nebel, Fnanz Richard Behrens oder Johannes R. Becher eben präzise die Möglichkeit hergeben, den Ungeist des Nationalsozialismus zu benennen. Dieses große Gedicht ist ein häßliches Gedicht, es kann gar nicht anders als häßlich sein in dem Sinne, wie etwa auch Otto Nebels Antikriegsdichtung „Zuginsfeld“ von 1919 häßlich ist: Schönheit muß um der Wahrheit willen unterlaufen werden, ebenso wie das expressionistische Pathos beschädigt werden mußte zum verhunzten Pathos, zum negierten Pathos, um die hohle und hoffnungslose Ästhetisierung des Politischen in den Nazi-Aufmärschen zu unterminieren, zu denunzieren.
Ich schlage vor, das Gedicht zu lesen als eines der Beispiele dafür, wie deutsche Autoren – neben Jandl Hans Wollschläger, Hans G. Helms, Arno Schmidt und Ulrich Goerdten – die Sprachtechniken im Ulysses und vor allem in Finnegans Wake von James Joyce für unsere Literatur fruchtbar machten. „wien : heldenplatz“ transponiert die (viel stärker auch musikalisch orientierte und wirkende) Polyphonie der Joyceschen Klang- und Bedeutungsschichtungen im Einzelwort, der „double talk“ die Lyrik; doch Joyce spielte mit dem Mythos, Jandl hat einen Mythos zu destruieren – daher die funktionelle Häßlichkeit des Gedichts, das die Häßlichkeit der national-sozialistischen Sprache destruktiv und konstruktiv äfft, imitiert und zur Wahrheit verzerrt und steigert. Es ist ein Gedicht, in dem – ein rarer Moment in der deutschsprachigen Literatur – die ästhetische Wahrheit nicht hinter der politischen Wahrheit herhinkt, sondern ihr gewachsen ist. „wien : heldenplatz“ ist ein Modell dafür, wie politische Dichtung aussehen müßte.
Jörg Drews: Über ein Gedicht von Ernst Jandl. In: Manuskripte, Heft 69/70, 1980 − Zu Ernst Jandls Gedicht „wien : heldenplatz“ aus dem Gedichtband Ernst Jandl: Laut und Luise.
http://www.planetlyrik.de/jorg-drews-zu-ernst-jandls-gedicht-wien-heldenplatz/2013/03/
wien : heldenplatz
der glanze heldenplatz zirka
versaggerte in maschenhaftem männchenmeere
drunter auch frauen die ans maskelknie
zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick.
und brüllzten wesentlich.
verwogener stirnscheitelunterschwang
nach nöten nördlich, kechelte
mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme
hinsensend sämmertliche eigenwäscher.
pirsch!
döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz
mit hünig sprenkem stimmstummel.
balzerig würmelte es im männechensee
und den weibern ward so pfingstig ums heil
zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte.