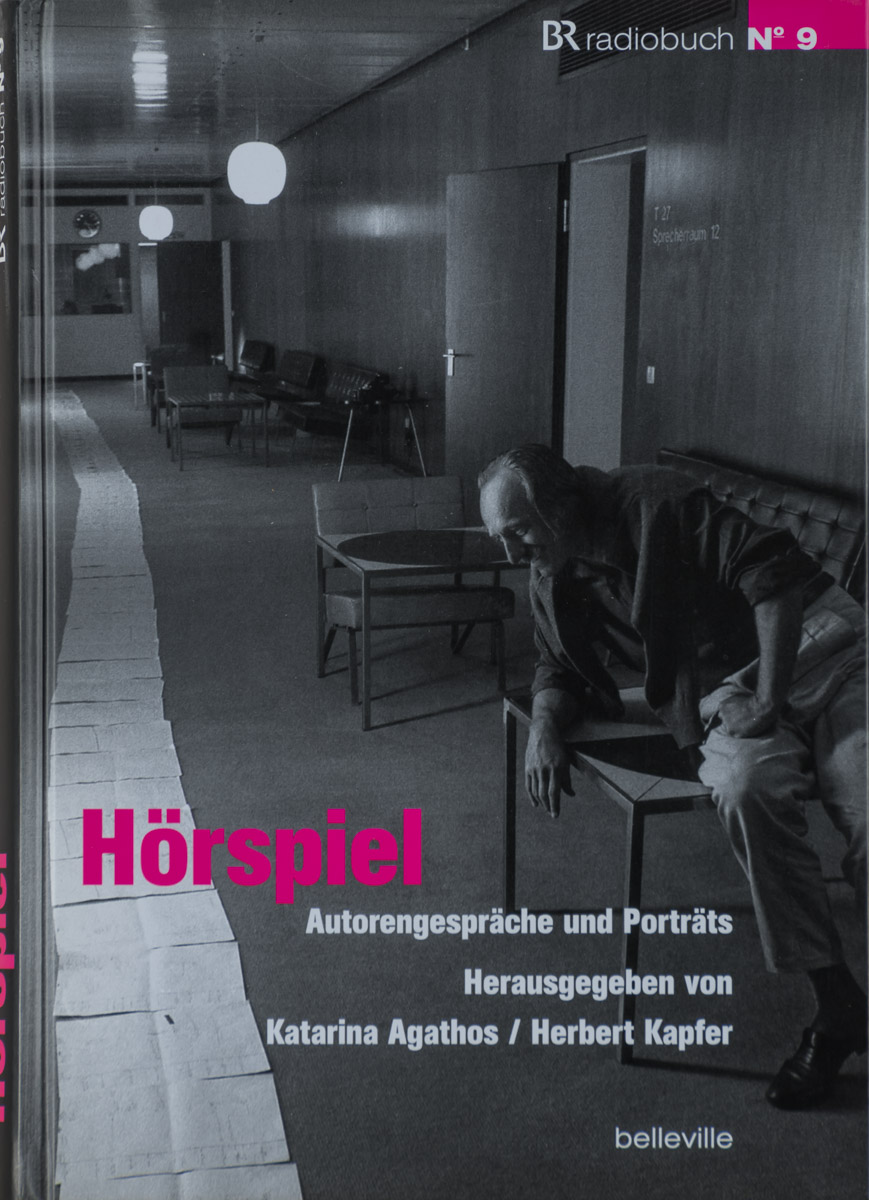Jörg Drews: Den Namenlosen einen Namen geben. Peter Weiss‘ Projekt einer „Ästhetik des Widerstands“.
Romanschriftsteller verwenden meist gesteigerte Aufmerksamkeit auf die Namen ihrer Gestalten, offenbar weil Namen, Personennamen, etwas Bedeutsameres sind als nur Bezeichnungen. Wenn einer in der realen Welt Müller heißt, dann ist dazu ja nichts Bedeutsames zu sagen: er heißt halt Müller, weder er noch seine Eltern haben den Namen gewählt. Heißt einer aber in der fiktionalen Welt, in einem Roman „Müller“, dann hat der Autor offenbar bewußt diesen Namen gewählt und will also, daß dieser Name etwas suggeriere, Zufälligkeit, Unauffälligkeit oder in anderen Fällen auch Auffälligkeit oder Skurrilität und dergleichen; er traut dem Namen eine Bedeutsamkeit zu, die Reste magischen Denkens enthält. Wir denken eben gerne, daß ein Name, auch unserer eigener Name, nichts Zufälliges, sondern etwas irgendwie doch Notwendiges, uns besonders Nahes sei; bei Verballhornungen unseres Namens sind wir eigenartigerweise sehr empfindlich, und nicht umsonst gibt es eine große Zahl redensartlicher Wendungen, die etwas mit Namen zu tun haben, zum Beispiel „sich einen Namen machen“ – obwohl man doch ohnehin schon einen hat. Laurence Sternes Roman „Tristram Shandy“ aus dem 18. Jahrhundert wendet unzählige Seiten auf die Erörterung des Namens des Helden, „Tristram“, und der biographischen oder charakterlichen Konsequenzen, die daraus vielleicht abzuleiten wären; das Resultat ist ein seufzendes „There is something in names“ – „es hat was auf sich mit Namen“. Namen sind sozusagen teil-identisch mit Personen. Will man das Andenken, die Erinnerung an eine Person stiften, so nennt man etwas nach ihnen und ist dann sicher, daß diese Person immer wieder genannt und also präsent gehalten wird. Übrigens ist jedes dörfliche Kriegerdenkmal Europas bis zur Washingtoner Schwarzen Mauer, in die die Namen von 55 000 in Vietnam gefallenen amerikanischen Soldaten eingemeißelt sind, ein Beleg für den magischen Umgang mit Erinnerung durch Namenslisten, und wer die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht hat, weiß, daß eines der bewegendsten Erlebnisse das Zuhören bei der unaufhörlichen Verlesung der Namen aller in KZs ermordeten Kinder in einem eigens dafür gebauten Raum ist.
Es ist deshalb kaum verwunderlich, daß Peter Weiss’ Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ an zentralen Stellen und in seiner Gesamtintention etwas mit dem Nennen, dem Aufzählen, dem Retten von Namen als dem dichtesten, kürzesten Inbegriff von Erinnerung und vor allem von Erinnerung an Menschen zu tun hat. Erinnerung und Eingedenken, Kampf gegen das Vergessen, die als politische und moralische Verpflichtung empfundene Aufgabe der dokumentarisch-sachlichen, der pietätvollen, der trauernden, der bisweilen auch fast sakral feierlichen, bisweilen geradezu ariosen Nennung von Namen ist eines der am stärksten strukturierenden Elemente des Buches, das man einen einzigen großen Kampf gegen die Namenlosigkeit und für die Namenlosen begreifen kann.
Aufzählungen von Namen und pointierte einzelne Namensnennungen gibt es bei Weiss schon in seinen Büchern vor der „Ästhetik des Widerstands“. Mit der rekapitulierenden Nennung von Namen, vor allem von Schriftstellern und bildenden Künstlern, wird immer stichwortartig etwas gesagt über den Stand der geistig-künstlerischen Entwicklung der Erzähler in den weitgehend autobiographischen Büchern „Abschied von den Eltern“ (1961) und „Fluchtpunkt“ (1962). Vor allem in „Fluchtpunkt“ finden sich mehrfach Aufzählungen von Malern und Autoren, von denen der Ich-Erzähler berichtet, daß er sie zu einem bestimmten Zeitpunkt kennenlernte bzw. zur Kenntnis nahm. Meist steckt in den Aufzählungen auch die Klage darüber, daß das Elternhaus und überhaupt die Schicht, aus der der Erzähler stammt, eine frühere Aneignung dieser Künstler verhindert und also auch die Entwicklung des Erzählers verzögert hätten; bürgerliche Herkunft und Exil, so diagnostiziert der Erzähler, sind schuld an solchen Verspätungen, die aber hier noch keinen politischen Aspekt haben. In einigen anderen Fällen aber – wenn es nicht um Dichter und bildende Künstler geht – werden Namen als Eingeständnis der Schuld des Vergessens aufgeführt. So erinnert sich der Erzähler in dem stark autobiographischen Roman „Fluchtpunkt“ namentlich an die Prager Freunde Lucie Weisberger und Peter Kien, von denen er noch 1942 aus Theresienstadt Nachrichten bekommt; er macht auch vage Versuche, ihnen zu schreiben und sie freizubekommen, aber dann erfährt er nur noch, daß sie „nach unbekanntem Ort verzogen“1 sind, und damit senkt sich Schweigen und Vergessen über ihr Schicksal. Daß er selbst davongekommen ist, ohne Verdienst, durch Zufall, empfindet der Erzähler als schwere Schuld. In „Fluchtpunkt“ heißt es:
„Lange trug ich die Schuld, daß ich nicht zu denen gehörte, die die Nummer der Entwertung ins Fleisch eingebrannt bekommen hatten, daß ich entwichen und zum Zuschauer verurteilt worden war. Ich war aufgewachsen, um vernichtet zu werden, doch ich war der Vernichtung entgangen. Ich war geflohen und hatte mich verkrochen. Ich hätte umkommen müssen, ich hätte mich opfern müssen, und wenn ich nicht gefangen und ermordet, oder auf dem Schlachtfeld erschossen worden war, so mußte ich zumindest meine Schuld tragen, das war das letzte, was von mir verlangt wurde.“2
Dies ist die persönliche Seite der Abtragung einer moralischen Schuld, welche „Die Ästhetik des Widerstands“ auch darstellt; die politische Seite ist die des damit verknüpften und von Peter Weiss ebenfalls als Schuld empfundenen notwendigen Eingeständnisses seiner a-politischen Haltung bis in die frühen sechziger Jahre. „Die Ästhetik des Widerstands“ verleugnet nicht so sehr – wie einige Kritiker meinten – Peter Weiss‘ Vergangenheit als daß sie diese vielmehr unter dem Aspekt einer moralischen und politischen Verfehlung bzw. Unterlassung darstellt und indirekt ergänzt, wunschhaft revidiert: rückwärts gewandt und utopisch zugleich.
Die Namensnennungen in der „Ästhetik des Widerstands“ erfolgen unter drei Aspekten: Einmal gibt es das Problem der Erinnerung und des Eingedenkens der unzähligen Opfer des Dritten Reiches, die gar nicht mehr genannt werden können, weil wir ihre Namen nicht kennen oder weil ihre vollständige Nennung jedes Werk der Literatur sprengen würde. Ihrer Zahl wurden eben nur – sarkastisch gesprochen – jene Listen gerecht, durch die sie die Nazis entindividualisiert, entmenschlicht, zu Zahlen – und das heißt: zu Unpersonen -degradiert hatten. Um die Gesamtheit der Toten doch irgendwie zu benennen, um die riesige Zahl doch stellvertretend zu nennen, ihnen – sagen wir einmal behelfsweise: – ‚gerecht zu werden’, mußte Weiss also einen anderen Weg gehen.
Zum zweiten sind in der „Ästhetik des Widerstands“ an vielen Stellen Aufzählungen von Schriftstellern und bildenden Künstlern zu finden, deren Nennung nun aber nur zum Teil unter dem Aspekt der individuellen Aneignung ihrer Werke durch den Erzähler, den sich zum Schriftsteller entwickelnden jungen Arbeiter erfolgt, sondern vor allem mit der Absicht einer Korrektur der sozialistischen und kommunistischen Kunstdoktrinen und Kunstgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts. Auf einer überpersönlichen Ebene wiederholt sich, was der Erzähler – mehr oder weniger mit Peter Weiss zu identifizieren – schon in „Abschied von den Eltern“ und „Fluchtpunkt“ für sich beklagt hatte: daß er diese Künstler zu spät oder gar nicht kennen gelernt hatte. Waren in seinem individuellen Fall die Herkunft und das Exil schuld, so ist die Schuld der Partei (und damit ist bei Weiss immer die Kommunistische Partei gemeint), dogmatisch, kurzsichtig im Drang der Tagestaktik diese Künstler von vornherein als dekadent, formalistisch usw. verdammt oder exkommuniziert zu haben, eine politische Schuld. Wie verständlich und historisch erklärbar auch immer – und Weiss geht ja seinem Verständnis für die Fehler der Arbeiterbewegung und der Kommunistischen Parteien Westeuropas wie Rußlands oft sehr weit – : der Fehler muß wiedergutgemacht werden, eben in und an der Entwicklung der ja eher nicht realistischen, sondern utopischen Figur des – übrigens namenlosen – Erzählers der „Ästhetik des Widerstands“.
Drittens ist nicht nur die Kulturgeschichtsschreibung der Partei zu revidieren, sondern die Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung und die diversen Parteigeschichten selbst. Politische Geschichte selbst muß ergänzt, revidiert, komplettiert werden; tabuisierte Namen müssen wieder genannt werden dürfen. In Stockholm bekommt der Erzähler während des Krieges, als er Kurierdienste versieht, das Manuskript eines Aufsatzes zum Ehrentag der Roten Armee in die Hände, das er weiterzuleiten hat. Offenbar schaut er in dieses Manuskript hinein, denn er bemerkt:
„Von Lenin, und von dem großen Jetzigen war die Armee aufgestellt und zum Ruhm gebracht worden. Kein Wort über ihren eigentlichen Gründer […] Nicht nur die Dörfer und Städte in Sowjetland lagen zertrümmert, verwüstet worden war auch dessen Geschichte, doch am Gesichtsausdruck des gealterten Einsiedlers [gemeint ist der Redakteur Rosner] sah ich, daß er meine Einwände nicht verstehen würde, daß er nur noch einen Kampf zwischen Phantomen führte, nichts mehr wußte von dem, wofür wir eines Tags würden Rechenschaft ablegen müssen.“ (III, 157)3
Gemeint ist jener „Gründer“ der Roten Armee, dessen Namen Weiss schon einige Jahre vor dem Beginn der Niederschrift der „Ästhetik des Widerstands“ zu retten und wieder öffentlich zu nennen versucht hatte: Leo Trotzki – was ihm prompt die entsprechende Schelte und Demütigungen für sein Stück „Trotzki im Exil“ (1970) aus Moskau und Ostberlin eingebracht hatte, für deren Kulturfunktionäre Trotzki immer noch eine Unperson sein sollte. Wenige Seiten vorher, ebenfalls im Krieg, schreibt Funk/Wehner (gemeint ist der spätere Herbert Wehner), diesmal unter dem Pseudonym Wegner, einen Aufsatz zum Gedenken an Rosa Luxemburg, den noch namenlose junge Erzähler liest:
„Dies war auch wieder ein solches in sich zerstrittenes Werk, voller Mut, voller Feigheit, voll krampfhaftem Geschichtssinn und erzwungenen Fälschungen, ein Wagnis hätte es sein können, den Namen der Revolutionärin in Erinnerung zu rufen, es wäre dabei ihrer Unbestechlichkeit gerecht geworden, jetzt aber widerfuhr ihr, ganz in den Dienst dessen gestellt, was sie so glühend kritisiert hatte, eher eine erneute Schändung. Doch vielleicht genügte auch schon, von ihr zu sprechen, die seit vielen Jahren aus den Annalen der Partei gestrichen war, zusammen mit ihren nächsten Mitkämpfern, die sie überlebt hatten, denn über sie zu schreiben bedeutete, selbst wenn es sich nur um ein paar Tiraden handelte, daß insgeheim darauf hingewiesen wurde, wer bei der Gründung der Partei, im Dezember Neunzehnhundert Achtzehn, neben ihr gestanden hatte, Verrufene, Ausgestoßene oder Ermordete, alle die Spartakisten, Brandler, Thalheimer, Knief, Flieg, Eberlein, Remmele, Frölich, nur einer aus ihrem Kreis war noch heil, Pieck, und von diesem, der, als einziger der alten Garde, der Partei vorstand, mochte Funk den Anstoß zu der kleinen Schrift erhalten haben.“ (III, 150)
Es geht – an dieser Stelle wie an vielen anderen – darum, Unpersonen wieder zu Personen zu machen, und vom ersten bis zum dritten Band werden um der Wahrheit willen und um der Wahrhaftigkeit und der Würde sowohl der Menschen wie der Parteigeschichte willen unzählige Namen beschworen. Im ersten Band sind es vor allem zahlreiche von der Partei als bürgerlich usw. verdammte Schriftsteller, von Kafka über Canetti bis Céline (I,183-186); im zweiten Band sind es – im Zusammenhang mit der Aufarbeitung und Aufbereitung der schwedischen Geschichte des Spätmittelalters und des 19. und 20. Jahrhunderts in Brechts damals geplantem Engelbrekt-Stück – vor allem die Namen von schwedischen Adeligen und Aufrührern, von konservativen, liberalen und linken politischen Führern und ihren Opfern, dann aber auch die Autoren und Titel der Bücher, die der Erzähler beim Verpacken von Brechts Habe vor der Abfahrt nach Finnland notiert (II, 312-319); im dritten Band schließlich finden sich vor allem Namen der im Untergrund in Deutschland politisch Tätigen und derer, die mit ihnen vom Ausland her in Verbindung stehen, von Sozialdemokraten bis zu den Kommunisten, und die Namen der deutschen Konzerne und Konzernherren, die mit Hitler kooperierten. Einige Beispiele sollen die Art des Umgangs mit Namen verdeutlichen,
„einige Namen hervortretend aus einem Gewirr von Beziehungen, wieder ein Sturz hinein in das Netzwerk von Namen, Namen, die für Mordlust, für geheime Organisationen standen“,
wie Weiss in den „Notizbüchern 71-80“ (1981) notiert. Aber die aufgezählten Namen stehen nicht nur für die Benennung und Brandmarkung von Mördern. Als Brecht in Peter Weiss’ Buch die Arbeit am Engelbrekt-Stück aufgegeben hat, macht sich der Erzähler, der als Brechts Eleve vorzustellen ist, an die Ausarbeitung der abschließenden Szenen des – wie er sagt – „Epos“. Der kranke Aufständische Engelbrekt – so erzählt er seinen Stück-Entwurf nach – macht sich auf zur Reise nach Stockholm zum Reichsrat, wird unterwegs abgefangen und mit seinen Leuten auf Schloß Goeksholm gebracht: und
„… nach diesem Sturz der Aufstieg zum Schlußbild, das vom Volk nichts, das die Obern nur zeigte, in ihrer Machtfülle, wieder ganz vorn. Auf breitem Podest, in der Mitte die drei Bischöfe, Thomas von Strängnäs, Sigge von Skara und Knut Bosson Nacht und Tag von Linköping, in glitzerndem Ornat, gehüllt in den Rauch geschwungner Weihgefäße. Sie hielten den Pergamentbrief hoch, mit der Liste aller Privilegien, die sie und die weltlichen Herrn sich zugesprochen hatten. Daran baumelte das dichte Gehänge der Siegel. Zu ihren Seiten standen rechts der Reichsmarschall Karl Knutsson Bonde, die Brüder Nils, Bo und Bengt Stensson Nacht und Tag, Mans Bengtsson Nacht und Tag, Nils Erengislessan und Eringisle Nilsson Hammarstad, Bo Knutsson Grip und Magnus Gren, und links Krister Nilsson Vasa, Knut Karlsson Örnfot, Gustaf Algotsson Sture, Knut Jonsson Tre Rosor, Karl Magnusson und Greger Magnusson Eka, Magnus Birgersson und Guse Nilsson Bat, und Nils Jönsson Oxenstierna. Und es kamen hinzu Engelbrekts Waffengefährten Herman Berman, Gotskalk Bengtsson und Bengt Gotskalksson Ulv, Johan Karlsson Färla, Claus Lange und Arvid Svan. Nur Plata und Puke fehlten. Was da oben stand, in Eisen und Silber, in purpurnen Mänteln, sich darbietend als höchste Einheit, war in sich zerrüttet von Eifersucht, Habgier und Mordlust, trug in sich die bittren Fehden um die größten Güter, die stärksten Burgen, die bedeutendsten Posten, den Thron, und hinter ihnen, in den Fenstern der Giebelhäuser, warteten die Großbürger, gekleidet in Samt und Pelzwerk, auf ihren Teil der Beute. Da wurde ihnen ein Gefangener zu Füßen geschleudert, ein Bauer wars, die Arme und Beine mit Seilen gebunden, ein zweiter folgte. Da sind sie, die letzten, rief Bengt Stensson Nacht und Tag, Goeksholm haben sie anzünden wollen, als wir zu Besuch weilten beim Ritter Nils Erengislesson. Rächen wollten sie einen gewissen Engelbrekt. Wer war denn das, Engelbrekt, rief Karl Knutsson, zu wüstem Gelächter. Nie gehört von einem Engelbrekt. Unbekannt, wie diese dort, sagte er, auf die Gefangnen zeigend. Der eine richtete sich auf. Hans Martensson heiß ich. Einer der Kriegsknechte unten versetzte ihm einen Hieb mit der Lanze. Namenlos bist du, rief Karl Knutsson. Ich heiße, sagte der Bauer noch einmal, und brach unter erneutem Schlag zusammen. Ich heiße, sagte auch der andre Gefangne, und, nichts heißt du, rief Karl Knutsson, und die Lanzen schmetterten auf den Landmann ein.“ (II, 308/9)
Das Schlimmste, das man jemandem antun kann, ist, seinen Namen der Vergessenheit zu übergeben, ihn auszulöschen zu versuchen; der schlimmste Fluch ist „Nicht gedacht soll seiner werden!“ Das kann aber auch umgekehrt werden: die Namen der Verbrecher sollen aufbewahrt werden, ihre Taten sollen nicht vergessen sein. In der vom Erzähler nacherzählten Szene, die zugleich – innerhalb der Fiktion – das erste von ihm verfaßte Stück Literatur darstellt, werden uns sowohl die Namen derer überliefert, die nach dem Willen der Mächtigen hätten ausgelöscht werden sollen, als auch die der Großen des schwedischen Reichs, der großen Übeltäter; später hören wir dann auch die Namen der Mächtigen des mit Nazi-Deutschland sympathisierenden Schweden, bis hin zu den Namen der schwedischen Polizeibeamten, die bei der Rückkehr der Kuriere Sager und Wagner diese verhaften und sie an Deutschland ausliefern wollen:
„Paulsson, Söderström, Lundqvist, Lönn“ (III, 136),
wie wir umgekehrt auch wieder in einer fast feierlichen Vereinzelung die fünf Namen derer erfahren, die am 14. Mai 1931 bei Streiks von der schwedischen Polizei erschossen wurden: „Eira Söderberg, Erik Bergström, Viktor Eriksson, Evert Nygren und Sture Larsson“. (II, 300)
Eine besondere Art von Liste findet sich kurz danach: Der Erzähler ist beim Katalogisieren der Bücher behilflich, die Brecht nach Finnland mitnimmt bzw. die ihm nachgeschickt werden sollen, und nun, unterbrochen von den Verhandlungen mit der schwedischen Polizei, die nach politischer Literatur sucht, lesen wir ein Verzeichnis der Brechtschen Bibliothek, in einer Ausführlichkeit, die jedem einzelnen Titel, jedem einzelnen Autor sein Recht und seine Würde geben soll, gerade angesichts der Gefährdung. Denn das Einpacken wird einmal auch vom Erzähler als ein „ins Grab senken“ (III, 316) bezeichnet – nicht von ungefähr, da unsicher ist, ob nicht irgendeine Polizei, die schwedische oder die finnische, die Bücher beschlagnahmen wird, und da außerdem unter den Autoren die fast vollständige deutsche Exilliteratur vertreten ist. Jedes Buch ist ein Individuum, nun eben nicht zur Vernichtung, sondern zur Bewahrung aufgelistet:
„jeder Name und Titel hier vollgedrängt von Lebensstoff […] Jetzt kamen sie von allen Seiten hinzu, die Chorführer, Hauptmann, Nexö, Rolland und Wedekind, die Posaunenbläser, Heym, Trakl und Loerke, die Pfeifer und Trommer, Dehmel, Mombert und Werfel, Kantorowicz, Kaiser Pinthus und Sternheim, ankündigend den Tod einer alten, die Geburt einer neuen Epoche, und da war Brecht schon dabei, ein Überlebender war er, schrecklich in seiner Nähe die Stille um Toller, Ossietzky und Tucholsky, und nun Mühsam, den sie erdrosselt, aufgehängt hatten im Klosett in Oranienburg. >Und es kam Lorca, blutüberströmt , aus seiner Sandgrube kam er, am Rand des Dorfes Viznar, bei Granada, Horvath kam, der so ängstlich war, daß er lieber alle Treppen erstieg, in den Hotels, als den Fahrstuhl zu nehmen, und der mitten am hellichten Tag, bei kurzem Windstoß auf den Champs Elisées vom stürzenden Ast eines Baumes geköpft wurde, und Roth, an Verzweiflung und Trunk umgekommen im weiten Paris, wo Döblin, Feuchtwanger und Benjamin, Polgar , Neumann und Frank, all die anderen Unbehausten und Umhertreibenden, die Verstoßnen und Befehdeten, auf nein Visum warteten, irgendwohin, und da waren Broch, der in New York sein Dasein fristete mit Armengeldern, und die befremdende Lasker-Schüler, tanzend an der Klagemauer zu Jerusalem, und die Fleißer, versteckt in Ingolstadt, und Jahnn, Orgel spielend auf Bornholm, möchten die Deutschen ihn für einen dänischen Landmann halten, und Musil, vereinsamt, hungernd in Zürich, und all die Reisenden, Kisch, Olden und Graf, Bredel und Renn, Regler, Klaus Mann, Seghers und Uhse, auf dem Weg nach H.“
Das ist das genaue Gegenteil einer Proskriptionsliste: keiner soll vergessen werden, aber nicht bei der Verfolgung, sondern bei der Rettung. Ich vermute, daß die Liste auch gedacht ist als Gegenstück zu den diversen Listen, die im Dritten Reich die zu verbrennenden, nicht mehr zu führenden, zu sekludierenden, aus Bibliotheken zu entfernenden Bücher aufführten, vom 10. Mai 1933 an und immer weiter, Gegenstück und Aufhebung auch sämtlicher (und nicht nur nationalsozialistischer) Zensurlisten, Ausbürgerungslisten und Häftlingsverzeichnisse. Die Liste als Instrument der totalen, totalitären Erfassung wird hier der Macht aus der Hand genommen und umfunktioniert; literarhistorisch gesehen wird hier auch, als Stilmittel bzw. als textorganisierendes Prinzip, wieder der antike epische Namenkatalog eingeführt, der Garant des umfassenden epischen Bescheidwissens des Autors.
Die Widerstandskämpferin und kommunistische Kurierin Lotte Bischof wiederum, im dritten Band, die die Namen so vieler Toter in sich trägt – neunzehn Seiten lang läßt sie der Erzähler (nach dem Bericht von der Hinrichtung in Plötzensee) die Namen und Schicksale derer memorieren, von deren Tod sie bis zum Ende des Krieges erfahren haben würde (III, 220-239) – , nimmt sich vor, nach dem Krieg Lehrerin zu werden, damit sie den Schülern, in deren Schule vielleicht eine Marmortafel an einige Opfer des Faschismus erinnern wird, „etwas von dem deutlich“ machen kann, „was sich hinter den goldenen Namen verbarg“. (III, 236) Sie selbst, die auf der Fahrt nach Deutschland in der Kajüte und dann im leeren Tank eines Schiffes lebendig eingesargt war, hat das Glück erfahren, mit Namen gerufen zu werden.
„Als sie, bei einem Geräusch oben an den Schrauben des Lukendeckels, auf die Uhr blickte, hätte sie nicht zu sagen gewußt, ob es vier Uhr morgens oder bereits vier Uhr nachmittags war, sie drückte sich wieder in die Furche des Bugs, bis sie Svaerds Stimme hörte. Lotte, rief er. Es war sonderbar, ihren Vornamen zu hören. Es war ihr, als hätte sie diesen Namen vergessen gehabt und als sei er ihr jetzt zurückgegeben worden. Der Name kam auf sie zu, wie eine große, unerwartete Freundlichkeit. Die Knie versagten ihr, als sie die Leiter emporklettern sollte. Svaerd streckte ihr die Arme entgegen. Sie ergriff seine Hände, ließ sich hinaufziehen. Und als sie dann, in der Morgendämmerung, auf ihrer Pritsche lag, wirkte der Laut des Namens noch in ihr fort. Iß, Lotte, du hast ja nichts gegessen, nichts getrunken. Wir fahren jetzt auf die Elbe zu. Dann fahren wir am Leuchtturm von Neuwerk vorbei, fahren die Ostfriesischen Inseln entlang, bis Borkum, dann in die Ems, nach Delfzejl. Da mußt du wieder in den Tank, Lotte, da laden wir die Bretter ab. Dann geht es weiter, zur Weser, nach Bremen. Jetzt kannst du schlafen, Lotte.“ (III, 82)
Eine der eigenartigsten und in dem Moment, da sie geschieht, gleich auch vorausdeutend poetologisch reflektierten Namensnennungen findet sich im dritten Band der „Ästhetik des Widerstands“. Während die Mutter des Erzählers, nach furchtbaren Erlebnissen auf der Flucht durch Ostpolen schon verstummt, fast schon gar nicht mehr anwesend, in der Küche in Alingsas herumgeht und den Tisch deckt, beschwört der Vater durch Namensnennungen
„die Gewalt herauf, die, wenn auch immer vor uns versteckt, unser Leben bestimmte. Im Gegensatz zu der für uns ungreifbaren inneren Welt meiner Mutter war dies das vollkommen Rationale. Es war ein riesiges metallisches System, vor dem die organische Substanz porös wurde, sich leicht zerreiben und wegblasen ließ.“ (III, 125).
Der Vater sagt die Namen der großen Konzerne und Konzernherren auf, die Hitler in den Sattel geholfen hatten oder doch auf jeden Fall unter seinem Regime kräftig expandierten und Profite machten und die weiterbestehen und weiterprofitieren würden (was sie ja dann auch taten):
„Krupp, Thyssen, Kirdorf, Stinnes, Vögler, Mannesmann …Duisberg …Haniel, Wolff, Borsig, Klöckner, Hoesch, Bosch, Blohm, Siemens …Flick …Henschel … Dresdner Bank …Deutsche Bank …IG Farben …“ (III, 126-128)
Diese Namen werden zweifach bezogen; einmal stehen sie als das „Rationale“, „Metallische“ für das, was in absolutem Gegensatz steht zum Organischen, „Natürlichen“, man kann sogar sagen (wenn man an die mythische Dimension denkt, für die die Mutter des Erzählers und die Gäa auf dem Pergamon-Fries steht, wird man das Wort trotz seiner Obertöne nicht mißverstehen): zum Mütterlichen und Erdhaften; gemeint ist jene Art Rationalität, die Horkheimer „instrumentell“ nannte. Und zugleich benennen diese Namen das Wider-Poetische par excellence; durch ihre Nennung wird auch das ästhetische Problem, die Schreib-Aufgabe des Erzählers, des jungen werdenden Schriftstellers angedeutet, der sich episch in mit traditionellen Mitteln kaum ,erzählbare‘ Bereiche hineinbegeben muß. Der Erzähler sagt – und dies deutet wieder darauf hin, daß Namensaufzählungen eigentlich ja etwas sprachästhetisch Reizloses – ein bewußt eingesetztes Element des Buches sind – :
„Waren Sie, deren Namen er nannte, auch nur Repräsentanten des Systems, das lange vor ihn en begonnen hatte, und nach ihnen weitergeführt werden würde, so war es für ihn, der hin und her schritt auf den knarrenden Bohlen, jetzt doch an der Zeit, sie direkt anzusprechen. Da ich ihm über meine literarische Arbeit berichtet hatte, war mir einen Augenblick lang, als sei nichts wichtiger für die Inganghaltung des Schreibens als das Durchsetzen der Sprache mit Materialien aus Regionen, die mit dem, was wir der künstlerischen Tätigkeit vorbehielten, nichts zu tun zu haben schienen. Ich hatte mich auch wieder gefragt, wie sich dies alles einmal zum Ausdruck würde bringen lassen. Wenn ich Hodann sagen wollte, was stattgefunden hatte in dem niedrigen, schiefen Zimmer meiner Eltern, draußen auf dem Schulhof die Bäume naß und schwarz, mußte ich das Abweichende mit einbeziehen. So konnte das, was sich als fremdartig ausgab, dargestellt werden. Sein Aufzählen von Namen schien zunächst ein Bruch zu sein mit allem, was wir gewöhnt waren. Daß die Namen uns bekannt und verflochten waren mit unserer Existenz, machte ihre Nennung nicht selbstverständlicher. Vielleicht drängte sich ein stilistisches Prinzip auf. Ich wußte nicht, wie ich das, was mit den Namen verbunden war, wiedergeben sollte. Erst später, im Januar, empfand ich die Notwendigkeit dieser erbitterten Auseinandersetzung, und trotz des Mißverhältnisses zwischen der dürr~ Nachzeichnung und dem ungeheuerlichen Modell stimmte ich dem hilflosen und zugleich wissenden Angriff meines Vaters zu.“ (III, 125 f.)
Die Pointe ist, daß sich das, was der Erzähler unter „dies alles“ zusammenfaßt, eben im herkömmlichen Sinn nicht „zum Ausdruck bringen“ läßt, in der Art also, wie Dinge, die im weitesten Sinn dem „Organischen“ zugehören, also auch der natürliche Tod, sich künstlerisch „zum Ausdruck bringen“ lassen: Namenlisten haben im Sinn der traditionellen Expressivität eben keinen Ausdruck – bekommen ihn aber in Peter Weiss‘ Buch paradoxerweise doch. Zugleich ist aber die Aufzählung des Vaters in der Tat „hilflos“, so wissend sie auch sein mag. Denn sie reicht nicht im entferntesten an das Leiden der Mutter heran, die bei der Namensnennung anwesend-abwesend ist, reicht nicht an die Leiden derer heran, die da geschunden und ausgebeutet wurden, wenn nicht im direkten Auftrag, so doch im Interesse des Profits derer, die der Vater aufzählt. Die Aufzählung des Vaters ist dem unermeßlichen Leiden nur abstrakt und beschwörend entgegengestellt:
„In seinem Anspruch auf Eindeutigkeit, auf Unwiderlegbarkeit trieb er die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hatte, in ein noch größeres Dunkel.“ (III, 125).
Mit anderen Worten: Die Vermittlung zwischen den beiden Sphären ist gar nicht mehr herzustellen und muß doch – erzählerisch, ,künstlerisch‘ – hergestellt werden; altmodisch gesprochen: die Sinnfrage ist durch die Nennung der Namen nicht zu beantworten, auch nicht die Frage danach, warum solche Leiden eigentlich Menschen von Menschen angetan werden – die Frage führt nur, entgegen der aufklärerischen Absicht des Vaters, in ein „noch größeres Dunkel“. Dies Dunkel aber ist nicht nur das der ungelösten Fragen der philosophischen Anthropologie oder der Metaphysik, sondern auch das von Brecht her bekannte: „Denn man sieht nur die im Lichte,/ Die im Dunkeln sieht man nicht.“ Der Vater nennt Namen, gehört aber selbst zu den im Buch an vielen Stellen apostrophierten Namenlosen.
Auffälligerweise bleibt eine Anzahl von Personen übrigens in dem ganzen Buch buchstäblich namenlos. Sie bekommen auf den fast 1000 Seiten keinen Eigennamen, obwohl von ihnen erzählt wird. Das sind vor allem der Vater und die Mutter des Erzählers und der Erzähler selbst. Die wichtigste Gestalt in diesem Komplex „Erinnerung“ und „Namensnennung“ ist die Mutter des Erzählers. Sie ist es, die sich bis zur völligen Selbstaufgabe dem Leid, dessen Zeuge sie geworden war, gleichmacht. Wie sehr sie sich mit den Opfern der Politik Hitlers und Stalins identifiziert, wird schon im ersten Band des Buches angedeutet. Als ihr Sohn, der Erzähler, seine Eltern 1939 in Warnsdorf in der Tschechoslowakei zum ersten Mal seit der Flucht aus Berlin wiedersieht, heißt es:
„Während sie mich ins Haus zog, sagte sie mir, daß sie, nachdem man sie ihres dunklen Haars wegen einige Male als Jüdin bezeichnet hatte, sich nun selbst zur Jüdin erklärt hatte, was es ihr und dem Vater jedoch schwer machte, in Warnsdorf eine Bleibe zu finden.“ (I, 189)
Nachdem sie Augenzeugin der Vertreibungen bei der Teilung Polens zwischen Hitler und Stalin geworden war und dann auch Leidensgenossin derer, die die ersten Opfer des berühmten Paktes von 1939 wurde – mit dem Vater gerät sie 1939/40 auf dem Weg von der Tschechei über Polen nach Schweden zwischen die Fronten; deutscher und russischer Einmarsch überrollen sie – , verstummt sie vor Entsetzen und ist damit – obwohl noch am Leben und nach Schweden entkommen – den namen- und sprachlosen Opfern gleich. Die Erinnerung an die Grausamkeiten hat von der Mutter „Besitz ergriffen“ (III, 124) – sie ist eine von der Vergangenheit ,Besessene‘, die stellvertretend für viele stirbt; genauer müßte man sagen: sie macht sich tot (vgl. III, 129).
Auf diese Verletzung und Verstümmelung ihrer Menschlichkeit deutet, wie man rückblickend bemerken kann, schon die Figur der Gäa in dem vor allem im ersten Band diskutierten Pergamon-Fries hin; deren Schmerz über die Niedermetzelung der „Kinder der Erde“ wird herausgelesen aus der Verstümmelung der Figur im klassischen Bildwerk. Die Beschädigung des Bildwerks präfiguriert auf der mythischen Ebene den späteren zum Wahnsinn sich steigernden Schmerz der Mutter. Daß die Mutter dem Stupor verfällt, aktivischer interpretiert: daß sie sich ins Schweigen zurückzieht, ist ihre Form des Protestes dagegen, daß alles so weitergeht. Sie zerbricht mimetisch am Übermaß des Leidens:
„Ließe sich ein Schrei in ihr wecken, kein Lebender könnte ihn ertragen […] Doch die Frage beunruhigte uns, ob sie nicht mehr wisse als wir, die wir Vernunft bewahrt hatten, und ob nicht alles, was nach unseren Normen erklärbar war, hinfällig werden müsse angesichts einer sich anbahnenden Umwälzung des Denkens.“ (III, 16)
„Erklärbar“ ist das Phänomen des Krieges und der Judenvernichtung etwa für den in Stockholm vom jungen Erzähler oft aufgesuchtenpolitischen Kommentator Rosner, der noch jeden Winkelzug der Politik – notfalls sogar den Hitler-Stalin-Pakt – mit dem Gang des Weltgeistes in Moskauer stalinistischer Gestalt in Einklang zu bringen versteht, wie auch zum Beispiel für den Vater, der die Namen der kapitalistischen Drahtzieher oder Gewinnler nennt und damit doch wenigstens andeuten kann, wie das System und in wessen Interesse es funktioniert. Wie die schwedische Schriftstellerin Karin Boye, die Selbstmord begeht, unter anderem weil auch sie für einen Moment, im Herbst 1932 im Sportpalast in Berlin, dem mythischen Begeisterungsrasen der Hitler-Anhänger anheimgefallen war und noch Jahre später darüber vor Scham vergehen will – wie Karin Boye also will die Mutter „dieses zur heillosen Vernunft verfälschte Leben“ (III, 39) nicht mehr mitmachen. Sie wird nicht geopfert, sondern sie o p f e r t s i c h s e l b s t, gleich als ob sie einen Teil der Gewalt gegen jene auf sich selbst ablenken wolle, als könne sie durch ihr Leiden etwas an deren Geschick ändern, mildern. Sie erträgt den Gedanken nicht, daß sie ohne eigenes Verdienst dem Schicksal, das andere in ihrer Nähe traf, um Haaresbreite entging. Die schrankenlose Identifikation der Mutter mit den Opfern macht ihre Würde aus, ihre (religiös gesprochen) Heiligkeit. Sie verhält sich den Leiden der Opfer entsprechend im Sinn des Worts, daß der keinen Verstand hat, der ihn angesichts mancher Tatsachen nicht verliert. Die Mutter ist das lebendige, also: sterbende Beispiel gegen einen verkürzten linken Begriff von der Vernunft in der Geschichte, und hier steckt auch, nebenbei gesagt, ein Stück christlicher Theologie bzw. christlicher Opfer-Philosophie in Weiss’ Buch; hätte man der namenlos bleibenden Mutter einen Namen zu geben, er wäre: Christa.
Daß die Mutter verstummt, macht allerdings auch ihre Wirkungslosigkeit aus. Beachtet man ihre Genese als Gestalt in den Werken von Peter Weiss, so bemerkt man, daß die Mutter in der „Ästhetik des Widerstands“ Kennzeichen eines Dichters aus einem anderen Text von Weiss übernimmt. In Peter Weiss‘ Stück „Hölderlin“ von 1971 nämlich fragt der Tübinger Mediziner Autenrieth im 7. Bild den fast sprachlosen Dichter: „Kann Er uns erklären was Ihm / in Frankreich wider fahren“. Hölderlin antwortet stammelnd:
„O wie die Sonne nieder sengte / und mich das pralle Licht verzehrte / als ich entflohen aus Bordeaux / die schreckliche Vendée durchkreutzte / wo es von Leichen aus der Erde schrie / und ich bei jedem Schritt auf Schädel/und Gebeine stieß im Acker.“
Die Opfer der Kämpfe in Polen 1939 und der ersten Massentötungen 1940 werden parallel gesetzt den Toten der Aufstände in der Vendee; überdies nimmt Weiss mit einem Teil der Forschung an, daß Hölderlin im Mai 1802 in Paris war und den Sieg der Konterrevolution miterlebte und daß dies den Ausbruch des Wahnsinns bei ihm beförderte. In einem Gespräch mit Volker Canaris bemerkte Peter Weiss 1971 über sein Hölderlin-Stück:
„… so scheint mir auch in diesem Stück Hölderlin der am wenigsten Gebrochene: nicht er ist umnachtet, die Welt, in der er lebt, ist umnachtet.“4
In einem klinischen Sinn mag also Hölderlin umnachtet gewesen sein, mag auch die Mutter des Erzählers in der „Ästhetik des Widerstands“ umnachtet sein; als Kunstfiguren aber, innerhalb des Bedeutungsgeflechts von Stück und Roman sind sie zwar Verkörperungen der Ohnmacht, doch ihre Umnachtung hat gewissermaßen ,heilige‘ Größe. Indem sie sprachlos werden, bewahren sie begriffslos, aber konkret die Leiden auf, deren Zeugen sie waren; doch die Erinnerung daran können sie nicht mehr kommunizieren. Die Mutter ist in dem Zustand, den der Mediziner Autenrieth Hölderlin betreffend so beschreibt:
„Patient traf Mitte Juni Achzehnhundert Zwei / aus Frankreich kommend / im Zustand geistiger Zerrüttung / in Stutgard ein woselbst ihn behandelte / OberAmtsPhysicus Doktor Planck / Anfänglich besänfftigt brach die Kranckheit / ein Jahr später aufs neue aus … Derselbe ist seit nunmehr fünf Jahren f mit Ausnahme einiger lucider Intervallen / vernünftiger Communication nicht mehr / erreichbar.“ (Bild 7)
Die Mutter ist eine Künstlerin, die sich nicht mehr ausdrücken kann; der Erzähler der „Ästhetik des Widerstands“ aber, ihr Sohn, erbt vom Hölderlin des Weiss’schen Stückes die Aufgabe, „innre und äußre Krafft zum Einklang zu bringen“; doch während Hölderlin am Ende des Stückes sein Scheitern eingestehen und bekennen muß:
„Ich war der Revoluzion idealisch so gewis / dass es mich grauenhaft aus den Zusammenhängen riss / als das Versprochene sich nicht mehr erkennen liess / und ich Gefangenschafft nur fand anstatt ein Paradis / Am Ende zwischen all den übermächtigen Gewalthen / vermocht ich nur mir mein Verstummen zu erhalten…“ („Hölderlin“, Epilog).
schafft der Erzähler der „Ästhetik des Widerstands“ gerade diese Aufgabe, diese Entwicklung. Er erreicht, was im Epilog des Stückes Hölderlin – neben sich selbst tretend und sich kommentierend als der noch sprachmächtige Teil seiner selbst – so formuliert:
„Sein Wunsch ist, dass man ihn nicht mehr verkenne / dass er sich nicht mehr opfre und verbrenne / will dass man ihn als einen zwischen vielen zählt / der Sprache sich zum Ausdruck und zur Kunst gewählt / nicht trennen will er aus dem Wirklichen den Traum / es müssen Fantaisie und Handlung seyn im gleichen Raum / nur so wird das Poetische u.n i v e r s a l / bekämpfend alles was verbraucht und schaal / erloschen und versteinert uns bedrängt / und was mit Zwang und Drohung unsern Athemzug beengt / Nie mehr will er in stiller Abgeschiedenheit vergehn / sondern als Lebender im Krais lebendger Stimmen stehn.“ („Hölderlin“, Epilog)
Die Mutter in der „Ästhetik des Widerstands“ ist mehrfach-determiniert. Einmal ist sie das moderne mythische, doch zugleich entmythologisierte Pendant zur Erdmutter Gäa aus dem Pergamon-Fries, „Ge, die Dämonin der Erde“. Zum zweiten ist sie der der Sprache der Dichtung nicht mehr mächtige Teil Hölderlins, und schließlich wird sie noch mit einer weiteren Gestalt und mit einer Figur auf einem Bild verglichen. Dem gilt es nachzugehen. In einer Unterhaltung zwischen Heilmann, Coppi und dem Erzähler im ersten Band sagt Heilmann auf die Frage von Coppis Mutter, „wie konnte es früheren Künstlern möglich sein, unter Tyrannen Beständiges hervorzubringen“:
„Die Gesamtkunst … die Gesamtliteratur ist in uns vorhanden, unter der Obhut einer Göttin, die wir noch gelten lassen können, Mnemosyne. Sie, die Mutter der Künste, heißt Erinnerung.“ (I, 77)
Die Mutter des Erzählers erinnert mit einer Intensität und Unverbrüchlichkeit wie keiner um sie herum sich der Opfer; mit dem mythischen Namen, der mit ihr in Verbindung gebracht wird, hängt der ganze Kontext der Künste und in der „Ästhetik des Widerstands“ speziell die Poetologie dieses Buches zusammen, das sich nicht unter die Obhut der Göttin Phantasie, sondern unter die der Göttin Eingedenken/Erinnerung stellt. Die Hilfe der Mnemosyne aber brauchte der Aoide, der Sänger, der lange Zusammenhänge aus dem Göttermythos und der Heldensage auswendig, stets neu modifizierend sang.
Nun gibt es bei dem von Weiss nicht nur in seiner Biographie, sondern auch in seinen Dichtungen genau studierten Hölderlin das in drei Fassungen überlieferte Gedicht „Mnemosyne“. Es geht nicht darum, ob Weiss’ Verständnis des Gedichts „Mnemosyne“ akzeptabel ist, sondern darum, was an dem Gedicht Weiss angezogen haben könnte. Vier Stellen des Gedichts scheinen mir genau in den Zusammenhang der Bedeutung der Mutter in der „Ästhetik des Widerstands“ zu passen. 1. Der Anfang der zweiten Fassung des Gedichts „Mnemosyne“ lautet:
„Ein Zeichen sind wir, deutungslos, / Schmerzlos sind wir und haben fast / Die Sprache in der Fremde verloren.“5
„Deutungslos“ ist die Masse dessen, von dem der Erzähler sagt, daß „dies alles“ einmal erzählt und ausgedrückt – also gedeutet werden müsse, und „schmerzlos“ muß sich paradoxerweise auch der Erzähler machen, um „dies alles“ erzählen zu können, ohne davon bis zur Sprachlosigkeit überwältigt zu werden (zu diesem Paradoxon, dieser Aufgabe gleich mehr); schließlich ist der, der in der Fremde die Sprache verloren hat, wie wir aus vielen Äußerungen wissen, Peter Weiss. Zweitens:
„Denn nicht vermögen / Die Himmlischen alles. Nämlich es reichen / Die Sterblichen eh an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo, / Mit diesen.“6
In Verbindung mit dem gegen Ende des Buchs programmatisch aufgelösten Herakles-Mythos werden den Menschen Aufgaben zugeschrieben, die weder Götter noch Halbgötter zu lösen vermögen und die eine „Wende“ der Geschichte herbeizuführen vermöchten. Drittens: In allen drei Fassungen des Gedichts ist von den gefallenen Freunden Achilles, Ajax und Patroklos die Rede, die „wie noch andere viel“ „göttlich gezwungen“ sterben mußten – wie die Helden des Widerstands. Entscheidend aber scheint mir, daß in der dritten Fassung von „Mnemosyne“ sogar vom Tod der Mnemosyne die Rede ist; sie kann nämlich in dem Sinne ,sterben‘, daß vom Leid überwältigte Trauer sich ganz nach innen wendet und nicht mehr aktiv Eingedenken stiftet:
„Himmlische nämlich sind / Unwillig, wenn einer nicht die Seele schonend sich / Zusammengenommen, aber er muß doch; dem / Gleich fehlet die Trauer.“7
Völlig in sich gekehrte Trauer „fehlt“, das heißt: lädt Schuld auf sich; die Himmlischen sind „unwillig“, wenn die Mnemosyne (= Trauer) „nicht die Seele schonend sich / Zusammengenommen“, denn sie „muß doch“. Das heißt: Trauer hat die Aufgabe, sich nicht vom Schmerz überwältigen zu lassen, sondern sie muß bei sich bleiben, ihrer selbst mächtig bleiben; sie darf nicht resignieren, weil sie sonst nicht mehr ihre Töchter, die Musen, zu erinnerndem Gesang inspirieren kann: Trauer muß zur Trauerarbeit werden. In diesem Sinn ist die Mutter die Verkörperung der zum äußersten gesteigerten Trauer, die aber alle Erinnerung und alle Äußerung dessen, was sie erinnert, mit sich nach innen nimmt und deshalb auch ihrer göttlichen Pflicht, Andenken zu stiften, nicht gerecht werden kann. So kann sie schließlich auch mit der stumm brütenden „Melencholia“ auf Dürers Holzschnitt vergleichen, der Erzähler aber darf sich nicht übermannen lassen von der Schwermut, politisch gesprochen: von der Resignation. Er soll den Toten wahren, was Hölderlin in dem Gedicht „Mnemosyne“ nennt: „[Und not tut] die Treue.“ Er soll vorwärts und rückwärts sehen und nicht „sich wiegen lassen wie / Auf schwankem Kahne der See.“8
Daß der Dichter „schmerzlos“ bleiben muß, um auch von den entsetzlichsten Erfahrungen um der Aufgabe der Stiftung von Erinnerung willen sprechen zu können, formuliert wieder Heilmann, im ersten Band der in Sachen Philosophie und Psychologie der Kreativität Avancierteste der drei jungen Genossen:
„Würden die Bestien Dante tatsächlich die Wunden schlagen, würden die Todeswütigen ringsum die Hiebe ausführen, die sie schon androhten, er hätte nichts mehr darüber zu berichten. Die Marter des Traums und der Dichtung, hatte Heilmann gesagt, sei die Auslieferung an eine Situation, aus der es kein Entrinnen gab, alles würde uns dort widerfahren, als ob es wirklich wäre, nur führe im Traum das nicht mehr Erträgliche zum Erwachen, so wie es sich in der Dichtung durch die Übertragung ins Wort befreie. Die Anästhesie gehöre auch zur äußerst beteiligten, Stellung beziehenden Kunst, denn ohne deren Hilfe würden wir entweder vom Mitgefühl für die Qualen anderer oder vom Leiden am selbsterfahrenen Unheil überwältigt werden und könnten unser Verstummen, unsre Schreckenslähmung nicht umwandeln in jene Aggressivität, die notwendig ist, um die Ursache des Alpdrucks zu beseitigen.“ (I, 83.)
So wird ihrem Sohn die Aufgabe übertragen, auf andere Weise den Toten die Treue zu halten: indem er nämlich ihr Schicksal kommuniziert. Er muß die Namen nennen, sich für das unmittelbare Leid ein Stück ,anästhesieren‘. Namensnennung im wörtlichen wie im erweiterten Sinn ist ein Kompromiß zwischen der absoluten Treue zu den Toten und der Zuwendung zu den Lebenden – um der Zukunft willen.
Namenlos aber bleibt im Buch auch der Sohn, unser romaninterner Erzähler, und dies aus mehreren Gründen. Einmal ist dies ein Indiz seiner eigenen Unerheblichkeit: Er soll nur das Medium sein, durch das Vergangenheit hindurchgeht – das ist die quasi-erzähltechnische Definition dieses Ich-Erzählers. Er ist noch ein ,Nobody‘, ein zukünftiger Künstler, der sich noch ,keinen Namen gemacht hat‘; er ist der Held eines politisch-literarischen Bildungsromans, der aber mit einer konkreten Künstler- Perspektive erst endet. Drittens schließlich ist der Ich-Erzähler natürlich (‚in einem gewissen Sinn‘) Peter Weiss, und er ist es auch nicht, Peter Weiss wie er unter anderen Umständen hätte sein können und vielleicht auch hätte sein mögen. Also kann dieser Ich-Erzähler keinen Namen haben, der Name muß in der Schwebe bleiben. Auch gebietet die Scham des Überlebenden, sich nicht mit einem individuellen Stil und einem eitlen Namen zu spreizen; die Scham darüber, überlebt zu haben, ohne sich irgendeines Verdienstes rühmen zu können, verhindert, sich als farbiges und lebenspralles Individuum aufzuführen, wenn es darum geht, von denen zu erzählen, die gar keine Chance hatten, sich zu einer Persönlichkeit zu entfalten. Der Sohn hat die Aufgabe, sich schreibend an den Toten, in Relation zu den Toten zu definieren. An ihnen wird er seine Identität als Schriftsteller finden; er hat noch keine, es geht alles durch ihn hindurch, er ist – wie der Fremde in Weiss‘ frühem Prosatext „Der Fremde“ – „Ein Nichts. Namenlos. Eine Art Seismograph.“9 Daher auch der so vieles nur registrierend-referierende Charakter des Buches: der junge Erzähler ist fast nur Registrator, Medium, Gefäß. Seine Identität ist eine utopische; noch ist er ein ,unbeschriebenes Blatt‘, und erst wenn er das Buch verfaßt haben wird, von dem er am Ende der „Ästhetik des Widerstands“ futurisch-konjunktivisch spricht, wird er ,sich beschrieben‘ haben.
Eine Spekulation in diesem Zusammenhang. Hat man erst einmal den engen Konnex der „Ästhetik des Widerstands“ mit Weiss‘ Hölderlin-Stück aufgespürt, also bemerkt, daß der Roman verdeckt die weitere Bearbeitung von Fragen darstellt, die der „Hölderlin“ am Ende sich gestellt hatte, dann liegt die Überlegung nahe, ob sich nicht noch weitere untergründige Verbindungen zum Werk und zur politischen Biographie Hölderlins in der „Ästhetik des Widerstands“ finden. Mir scheint zum Beispiel, daß Heilmann und Coppi, die beiden (auch in der außerfiktionalen, historischen Realität) Mitglieder der Widerstandsgruppe der „Roten Kapelle“, und ein Dritter, nämlich der Erzähler, der Künstler, eine Dreier-Gruppierung bilden, die angelehnt sein könnte an die Gruppierung Hegel-Schelling-Hölderlin im Tübinger Stift im Jahr 1792/93. Die drei waren Mitglieder des berühmten „Clubs“; alle drei sollen beteiligt gewesen sein an der Errichtung eines Freiheitsbaums in oder bei Tübingen am 14. Juli 1793; die Losung, unter die sie ihre weitere Arbeit gestellt hatten, war „Reich Gottes!“, und Hölderlin und Hegel speziell hatten sich bei ihrem Abschied im November 1793 als eine Art Schwur oder Devise gegeben: „Bei den zu Marathon Gefallenen!“ Man kann die drei in Berlin 1937, Heilmann, Coppi und den Erzähler, als Pendants auffassen zu den drei in Tübingen, die „Rote Kapelle“ als eine Art historisches Gegenstück zu den verschworenen drei in Tübingen in dem gegen den württembergischen Feudalabsolutismus sich richtenden Club, und die Losung „Reich Gottes!“ kann Weiss auch gelesen haben als einen zu säkularisierenden Hinweis auf die erstrebte Verwirklichung einer klassenlosen Gesellschaft. Auch die am Ende ihrer gemeinsamen Zeit in Tübingen zwischen Hegel und Hölderlin gewechselten, einer geheimen Devise ähnlichen Worte „Bei den zu Marathon Gefallenen!“, historisch gemeint als Eingedenken derer, die für die Erhaltung des Griechentums gegen die Barbaren gefallen waren, könnten in der „Ästhetik des Widerstands“ von Weiss verwandelt worden sein in die Intention des Gedenkens derer, die als Opfer des Kampfes gegen den Nationalsozialismus ,gefallen‘ waren. – Die Losung aber, die sich die drei jungen Proletarier geben, als sie sich in Berlin im Herbst 1937 trennen, heißt: Herakles. Um ein richtiges Verständnis dieser mythischen Figur kreisen ihre Gedanken bis zum Schluß.10
Übrigens kommt Peter Weiss in der „Ästhetik des Widerstands“, die man ja auch als eine nichts beschönigende Sammlung von Erzählungen über Märtyrer lesen kann, nicht nur nicht ohne die Dimension des Mythischen aus, sondern auch nicht ohne die Dimension bzw. die Deutungskategorie des Heiligen oder der Heiligen. Der Redakteur Rosner wird einmal, wie schon bemerkt, halb spöttisch der „Hieronymus der Komintern“ genannt – modernes Gegenstück also zum hl. Hieronymus im Gehäuse, der die Heilige Schrift studiert und auslegt; Hodann kann gesehen werden als ein zweiter Sebastian, von Zweifeln durchbohrt und todgeweiht. Bei Lotte Bischoff spricht der Erzähler selbst ausdrücklich davon, er sei „in Versuchung, sie eine Heilige zu nennen“. (III, 267) Es gibt sogar eine Sequenz von Bildern quer durch den ganzen Roman, die als Halluzinationen bzw. – wenn man es entpsychologisiert – als Visionen von der Auferstehung der Toten und als Himmelfahrten zu lesen sind. So taucht zum Beispiel in einem seltsamen Trancezustand des Erzählers sein Vater einmal aus dem Fußboden der Berliner Wohnung auf (I, 92) – der Vater ist realiter schon abwesend, in der Tschechoslowakei, erhebt sich aber wie ein schon Verscharrter aus dem Grab: er ,aufersteht‘. Später sieht die Mutter – gewiß schon im Zustand geistiger Verwirrung, wenn man es an der Psychologie der Normalität messen will – die tote Karin Boye auftauchen aus der Erde und buchstäblich zum Himmel auffahren (III, 35-36), und ganz am Ende des Buchs tauchen die Eltern des Erzählers für einen Moment aus dem Geröll auf, das zugleich der Schutt der europäischen Geschichte und der Trümmerschutt am Fuß des Pergamon-Frieses ist, wo die „Kinder der Erde“ angesiedelt sind. (III, 267)
Und noch zwei Namenlose läßt Weiss – sozusagen in einer Seitenkapelle seiner Kathedrale – auferstehen; er kann sie allerdings nicht beim Namen nennen, weil ihre Namen wirklich nicht mehr auszumachen sind. Nur die Kunst, nämlich eine Zeichnung Géricaults, hat sie festgehalten, und wie psychopathisch Géricaults Interesse an den Toten in der Morgue auch immer gewesen sein mag, das Bild wird aktualisiert und in eine Sphäre von Bedeutung überführt: Die darauf Abgebildeten werden zu Stellvertretern aller namenlosen Opfer, und ihr Bild ist im Roman auch die Antizipation des Aussehens derer, die in Plötzensee hingerichtet werden und von denen wir zwar die Namen, aber kein Bild als Tote haben:
„Die beiden abgehackten Köpfe lagen auf zerknülltem, grauweißem, blutfleckigem Tuch. Kissen, unter das Laken geschoben, gaben den Häuptern Halt. Wären nicht die rohen Schnittflächen an den Hälsen, das wäßrig ausgeronnene Blut zu sehn gewesen, so hätte der Eindruck eines im Bett nebeneinanderliegenden, vom Tod überraschten Paars entstehen können. Mit Schwarz und Weiß und einem geringen Zusatz von bräunlichen und rötlichen Tönen war das Bild gemalt. Das Antlitz der Frau war dem Mann zugewandt. Ihr Mund war leicht geöffnet, zwischen den umschatteten Lidern glänzte ein Punkt vom Augenweiß. Eigentümlich nackt ragte das Ohr aus dem zur Guillotinierung kurzgeschnittnen Haar hervor. Das Gesicht des Mannes, mit dem Anflug eines Barts um die eingefallnen Wangen, war noch vom Entsetzen geprägt. Die tief in den Höhlen liegenden gebrochenen Augen standen offen, auch der Mund war aufgesperrt, die klaffenden Lippen, die Zähne, die Zunge schienen noch den letzten Schrei zu tragen. Ihn mußten sie zum Fallbeil geschleppt haben, die Frau hatte vorher aufgegeben. Es wäre vermessen gewesen, die Erloschenheit auf ihrem Gesicht mit einem Frieden zu vergleichen, denn wie hätte, auch nach dem Eintreten der endgültigen Ruhe, der Gedanke des Friedens mit ihrer Existenz verbunden werden können. Und doch enthielten ihre Züge, fahl beleuchtet auf Schläfe, Jochbein, Nase und Kinn, etwas Weiches, ihr Kopf lag da wie eine überreife, abgefallne Frucht. Der Mann war herausgerissen worden aus seinem Dasein. Die Kinnmuskeln, die scharf vorgewölbte Nase und die zerbuchtete Kontur des kahlen Schädels drückten noch eine Anspannung von Energie aus. War die Frau völlig entmachtet, so hatte er sich, so lange ein Atemzug in ihm war, gewaltsam zur Wehr … gesetzt. Das Bild hing an der Seitenwand eines kleinen Nebenraums im Nationalmuseum.“ (II, 119-120)
Zwei Namenlose aus dem Leichenhaus in Paris, das im selben Abschnitt der „Ästhetik des Widerstands“ der Vorhölle in Dantes „Divina Commedia“ gleichgesetzt wird: „Wie hieß es, rief ich, wie hieß es doch, als der Sprecher eingetreten war in die Stadt, von der aus der Weg sich hinabschraubte in die Unterwelt.“ (II, 123) Man kann leicht ergänzen, wie es da bei Dante hieß:
„Ihr die ihr hier eintretet, laßt alle Hoffnung fahren.“11
Es handelt sich um den Ort, das Reich, in dem die Entmenschlichung der Eintretenden dadurch besiegelt wird, daß sie keine Namen mehr haben, nur noch Nummern sind: die Vorhölle und das KZ.
Peter Weiss ist, nebenbei bemerkt, nicht der einzige Schriftsteller, der mit den Namen, insbesondere von prominenten historischen Personen, im Umkreis der Geschichte des Dritten Reichs seine Schwierigkeiten hatte. Alexander Kluge hat 1964 in seinem Quasi-Roman „Schlachtbeschreibung“ , dem Bericht vom – wie es im Untertitel heißt: – „organisatorischen Aufbau eines Unglücks“ jedenfalls in manchen Passagen der frühen Fassungen des Buches, zum Teil Abkürzungen benützt wie „Hi.“ für Hitler; Brecht nennt in den „Flüchtlingsgesprächen“ Hitler den „Anstreicher“ und läßt Ziffel und Kalle den Namen Hitlers nie aussprechen; Ruth Andreas-Friedrich behält bei der Veröffentlichung ihres Tagebuchs „Der Schattenmann“ von 1947 die Decknamen von bestimmten Personen bei, beläßt also absichtlich die Helfer und Wohltäter der Widerstandskämpfer in der Anonymität bzw. der Pseudonymität; von Klaus Stiller gibt es einen Erzählungsband mit dem Titel „H.“12 – gemeint ist natürlich Hitler, aber die volle Nennung des Namens scheint Stiller den Mann zu häßlich-massiv präsent zu machen, und Karl Valentin schließlich soll in manchen Szenen sogar vorgegeben haben, es falle ihm der Name Hitlers gerade nicht ein: „Der Dings, der … wie heißt er denn gleich wieder?“ – was ja auch eine Verkleinerung, Verhöhnung, Unwichtigerklärung des Gemeinten ist oder sein soll. Bei Weiss taucht zum Beispiel auch ein Ortsname, den wir alle kennen, als Bahnknotenpunkt „Oswiecim“ ganz beiläufig auf, als sei die Nennung des deutschen Namens nicht zu bewältigen gewesen, als müsse eine Art apotropäischer Zauber angewendet werden. „Wenn man einen Geist zwingt, indem man sich seines Namens bemächtigt, so hat man Magie gegen ihn gebraucht“, heißt es bei Freud13; und mit dieser Intention, mit diesem Effekt nennt der Vater in der „Ästhetik des Widerstands“ die Namen der Konzerne und Konzernherrn: damit hält er sie fest und entzaubert sie zugleich, indem er sie nennt. Doch in Namensnennung steckt auch Ambivalenz; bei manchen Primitiven dürfen die Namen von Toten nicht genannt werden, damit sie niemand mehr sind.
Umgangen, umschrieben, nicht genannt werden in der „Ästhetik des Widerstands“ aber zwei Namen, die doch für die Jahre zwischen 1937 und 1944, von denen das Buch berichtet, wichtig waren. Was Nazi-Deutschland angeht: Göring wird ein Mal beim Namen genannt („Göring forderte die Befreiung der Deutschen in Böhmen und Mähren“; I,286), ansonsten eher höhnisch umschrieben etwa als der „Germane“ (III, 83). Himmler taucht ein Mal mit Namen auf, nur wie mit spitzen Fingern angefaßt, als sei der Erzähler von Grauen geschüttelt und versuche, auf Distanz zu gehen : „… jener namens Himmler“ (I, 300). Hitler aber und Stalin, werden im ganzen Buch nicht mit Namen genannt. Weiss vermied dies wohl deshalb, weil es erstens eine falsche Personalisierung der ganzen Untaten darstellen würde, die doch eben nicht ursächlich allein aus diesen Gestalten zu erklären oder damit gar zu entschuldigen sind; weder sollen die Deutschen alles auf Hitler noch die Kommunisten alles auf die angeblich einmalige Fehlentwicklung eines ,Personenkults‘, sprich: Stalin, schieben können. Zweitens wäre mit ihrer Nennung zugleich ihre so überwältigende negative Aura gegenwärtig, was in einem Buch mißlich wäre, in dessen Zentrum der Kampf gegen das Böse in Gestalt des Faschismus und die Kritik am „Prinzip der Diktatur von oben“ stehen. Aus politischen wie aus moralischen Gründen soll ihnen nicht die Ehre einer Namensnennung zuteil werden, wie ja auch der italienische Schriftsteller Guido Ceronetti schon zum Namen Napoleon voller Unbehagen registrierte:
Es genügt die magische Kraft des verhaßten Namens, ihn zurückzurufen.14
Von des Erzählers älterem Freund und Lehrer Hodann werden übrigens in einer seiner Umschreibungen Stalin und Hitler ausdrücklich gleichgesetzt: „… haben wir in den letzten Jahren unterm Schatten der Menschenvertilgungen durch den einen Autokraten gestanden, so zählen wir nun, sagte er vor seiner Haustür, ehe er hinter der die Birken spiegelnden Glasscheibe verschwand, was der andere an Mordtaten leistet, und was alles Vorherige zu übertreffen scheint.“ (III,48) Gemeint sind die Opfer des Stalinismus in den dreißiger Jahren und die Opfer in den KZs der vierziger Jahre. Und noch einmal werden Hitler und Stalin gleichgesetzt. Für einen winzigen, unauffälligen Moment wird im dritten Band aus der Perspektive des Bewußtseins der aus Entsetzen schwermütigen Mutter erzählt und von ihrer Wahrnehmung bzw. ihren Gesichten gesagt:
„In ihrem Wohnzimmer in dem alten Haus stand meine Mutter am Fenster und blickte hinüber zum Schulhof, wo sie ein Kind sah, das weder sprechen noch schreien konnte und an dem zwei Ratten festgebissen hingen.“ (II, 26)
Das Kind heißt Polen, die Ratten Hitler und Stalin.
Der Name des Herakles wird als mythische Identifikationsfigur sozusagen versuchsweise eingeführt:
„Weil eine mythische Figur / erscheinen muß / jetzt / da das Feuer der Grossen Revoluzion erloschen“
lautet die Antwort auf die Frage, warum Empedokles als Exempelfigur eingeführt worden sei, im 6. Bild von Weiss‘ „Hölderlin“, für dessen Epoche damit natürlich auch Napoleon gemeint ist. Aber Herakles wird progressiv und programmatisch abgebaut und schließlich spät im 3. Band der „Ästhetik“ zum letzten Mal genannt, über fünfzig Seiten vor Ende des Buches, im Abschiedsbrief Heilmanns, in einer Apostrophe, die auch ein skeptischer Seufzer sein könnte: ,,O Herakles.“ (III, 210) Das ist Weiss‘ Abrechnung mit dem Personenkult, sprich: der Hoffnung, besser: Verblendung, daß ein großer Führer, ein linker oder rechter, es schon welthistorisch richten werde. Die mythischen Bezüge müssen hinfällig werden und ersetzt durch ein handelndes Kollektiv; gerade auch im Kommunismus dürfe nicht Hoffnung auf einzelne Führer gesetzt werden, auf ,Erlöser‘, auf ,Retter‘. Auf der letzten Seite des gesamten Buches stellt sich der Erzähler vor, wie er eines Tages wieder – wie mit Heilmann und Coppi 1937, zu Beginn des Buchs – vor den Pergamon-Fries treten würde, aber der Name Herakles wird nicht mehr genannt, er wird programmatisch ausgespart:
„ … und ein Platz im Gemenge würde frei sein, die Löwenpranke würde dort hängen, greifbar für jeden, und solange sie unten nicht abliessen voneinander, würden sie die Pranke des Löwenfells nicht sehen, und es würde kein Kenntlicher kommen, den leeren Platz zu füllen, sie müßten selber mächtig werden dieses einzigen Griffs, dieser weit ausholenden und schwingenden Bewegung, mit der sie den furchtbaren Druck, der auf ihnen lastete, endlich hinwegfegen könnten.“ (III, 267/8)
Geschichte, die nach Weiss durchaus noch mythisch verlief im 20. Jahrhundert – im Marxschen Sinn einer „Vorgeschichte“, in der wir uns als unserer selbst noch nicht mächtige historische Subjekte befinden – , muß sich in jeder Hinsicht vom Mythischen, von mythischen Unfreiheiten emanzipieren. Zumindest muß den ewigen mythischen Mächten, einer Geschichte, die mit Recht mit Begriffen wie „Seuche“, „nationale Panik“, „Wahn“, „Verblendung“, „verdorbenes Volk“, „Pest“, „Epidemie“, „Fieber“, „Krankheit“ bezeichnet werden kann, ebenso hartnäckig der „Drang zum Widerspruch“, zur „Gegenwehr“ (III, 265) entgegengesetzt werden. Solange Geschichte mythisches Unheil enthält, gilt nur ein Gegen-Mythos: Widerstand.
Der Melancholie, die in diesem Sinne naturhaft-mythische Reaktion auf das Unheil ist, politisch gesprochen: der Resignation, ist Peter Weiss‘ Buch selbst abgewonnen. Wenn sein Erzähler fast wahnsinnig wird (III, 119 ff.), weil er den Chor der Verdammten aus dem Inferno, sprich: KZ zu hören vermeint, „schwinden ihm nicht die Sinne“ (III, 124), sondern er „springt“ zum kommunistischen Arzt Hodann, der sein Lehrer in Nicht-Resignation ist. Mit einem Epitaph auf eben diesen Hodann hätte die „Ästhetik des Widerstands“ zunächst enden sollen, mit einer 25 Seiten langen Schilderung von Hodanns einsamem, elendem Tod in der Schweiz 1946. Weiss hat diese Passage aber dann ausgegliedert und nur in seinen „Notizbüchern 1971-1980“15 überliefert. Die Versuchung muß groß gewesen sein, das Buch auf einem so düsteren Ton enden zu lassen. Zwei Prosatexte, die in der ZEIT kurz nach Weiss’ Tod (21. Mai 1982) veröffentlicht wurden, tragen die Überschrift „Es leben die Toten“, und das ist sehr doppelsinnig zwischen trotzigem Hochruf und verzweifeltem Hochruf angesiedelt; die Überschrift scheint voller Versuchung zum Einverständnis mit allen Resignierten, Gescheiterten, Toten, mit der schließlichen Zwecklosigkeit all unserer Anstrengungen im Wachzustand, auch wenn wir uns unverdrossen zuversichtlich zu benehmen versuchen. Am Ende des Textes „Es leben die Toten“ rettet Weiss sich gerade noch in das Wach-Wirkliche, gegen die einzige wirkliche Gewißheit, die da heiße: „gleich ist es zu Ende.“ Dieser Ton wäre jedoch zu hoffnungslos gewesen; eine breite Schilderung von Hodanns Sterben hätte wie ein Dementi des ganzen Buches geklungen. Der Tod hätte die Oberhand behalten, und dies durfte nicht sein. „Denn die Melancholie ist die dunkle Zwillingsschwester der Utopie“30, doch das Buch sollte eben nicht nur trauern, sondern Trauerarbeit leisten. Utopie ist in Weiss‘ Buch von den hohen Vorstellungen vom „Reich Gottes“ oder auch einer „versöhnten Gesellschaft“ herabgestimmt zu der simplen Hoffnung, daß der Widerstand gegen das Böse nie aufhören werde.
Literaturästhetisch und literaturpolitisch schließt die „Ästhetik des Widerstands“ mit einem kleinen Akt des Widerstands. Jochen Vogt hat schon bemerkt, daß am Ende der Erzähler einer ähnlichen Aufgabe gewärtig wird wie der Erzähler in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Da scheint mir nicht nur eine hübsche historische Reminiszenz vorzuliegen, sondern der Bezug auf Prousts „Recherche“ ist ein sinnvoller kunstpolitischer Akt, eine Absage an jene linken Kulturauffassungen, die in Prousts Werk nur eine individuelle ästhetisch-religiöse Anstrengung sehen oder sahen und den Roman nur als Darstellung der ohnehin nur dem verdienten Untergang geweihten schmarotzerischen Pariser Großbourgeoisie und des Faubourg-Adels. Sicher hat Weiss‘ Roman eine politische Dimension, die als unmittelbare der „Recherche“ abgeht, doch beide Bücher sind Bücher des Eingedenkens, bei Weiss nicht nur als Widerstand gegen das Verrinnen der Zeit überhaupt, sondern gegen das Vergessen der Namenlosen und der Namhaften. Wenn man so will, ist das ein uneitleres, überpersönlicheres Ziel als das Prousts. Am Ende eines der schrecklichsten Prosatexte, die die deutsche Literatur kennt, am Ende der Schilderung der Hinrichtung der Mitglieder der „Roten Kapelle“ in Plötzensee im 3. Band der „Ästhetik des Widerstands“ heißt es:
„Da hingen sie alle, unter der Schiene, der Hals lang gezerrt, der Kopf abgeknickt, zu erkennen waren sie nicht mehr, nur ihrer Reihenfolge nach hätte Schwarz ihre Namen noch nennen können, doch die verloren sich auch schon in einer Leere.“ (III, 220)
Gänzlich sinnlos wären die Opfer erst, wenn noch nicht einmal die Namen der Geopferten erinnert würden. Dem folget nicht – mit Hölderlin zu sprechen – „deutscher Gesang“, sondern eine Prosa, die sich vom Gesang bis ins Tonlose und Unscheinbare entfernt hat.
Die Arbeit an der „Ästhetik des Widerstands“ muß auch etwas an Peter Weiss‘ Verhältnis zu Deutschland verändert haben. Immer wieder läßt er zwar seinen Erzähler im Buch betonen, daß er sich der deutschen Sprache nur als einer Art Handwerkszeug bedienen wolle, also ohne das, was emotional das Verhältnis zur Muttersprache ausmacht. Als er sich anschickt, die Schlußszenen des Engelbrekt-Stückes zu entwerfen, heißt es: „Indem ich beim Übersetzen des Materials, das in der Sprache dieses Landes [= Schweden] verwurzelt war, in meine eigne Sprache das Allgemeingültige fand, verschwand die Kluft zwischen den Sprachen, die Sprache, die ich benutzte, war nur noch ein Instrument, zugehörig einer Weltwissenschaft.“ (II,306) Mit diesem forcierten Internationalismus, der die Beschränktheiten und Probleme regionaler Sprachen übersteigen möchte, scheint aber etwas nicht zu stimmen. Immerhin notiert Weiss im Winter 1977/78 innerhalb weniger Tage, im Zusammenhang mit Überlegungen zu seiner Rede bei der Entgegennahme des Thomas-Dehler-Preises:
„ … nachdem mir das Schreiben in diesem Deutschland nicht verboten sondern belohnt wird …“; „ich gehöre zu denen, die kein Vaterland haben“; „Ich war Tschechoslowake“; „Weil ich nie Nationalist war, kann mich die Existenz zweier deutscher Staaten nicht stören“; „Im Exil habe ich zwei Jahrzehnte lang für die Schreibtischschublade geschrieben. Das nicht mehr!“; „Der Verlust der Sprache ist eine Zerstörung der zentralen Persönlichkeit.“ 16
Nachdem paradoxerweise er, der skandinavische Emigrant, der nie einen deutschen Paß hatte, ein Buch über Deutschland geschrieben hatte – und das im emphatischsten Sinne, obwohl die „Ästhetik des Widerstands“ eben nicht ein Buch aus Deutschland und nur über Deutschland ist – , konnte Weiss sich wieder ein Leben in Deutschland vorstellen, allerdings bezeichnenderweise weder in West- noch in Ost-Deutschland, sondern in Berlin, der Stadt, in der er geboren worden war und in der er um 1930 herum mit seiner Familie gelebt hatte, der Stadt, die ja, wenn auch nicht gerade eine ganz „selbständige politische Einheit“, so doch ein Drittes war zwischen den beiden deutschen Staaten.
1947 war er zum ersten Mal nach 13 Jahren wieder in Berlin gewesen, mit höchst zwiespältigen Gefühlen, an die er sich rückblickend, während der Arbeit an der „Ästhetik des Widerstands“, mit folgender Notiz erinnert:
„ … die Hemmung, mich dieser Sprache zu bedienen, die Namen der Ungeister auszusprechen, magisches Ausweichen, um nicht alles Unglück der Welt heraufzubeschwören …“17
Doch die Versenkung in den finstersten Abschnitt der deutschen Geschichte, in dem es aber auch Widerstand gegeben hatte, wofür stellvertretend die Namen Heilmann, Coppi, Bischoff, der Mitglieder der „Roten Kapelle“ und anderer im Buch stehen, scheint ihm eine größere Nähe zu Deutschland wieder möglich gemacht zu haben, und schließlich erfuhr er in Berlin auch, wie wichtig sein Buch einer Anzahl deutscher Studenten und Intellektueller war, daß also die Verdrängung der Vergangenheit in Deutschland nicht vollständig war. Es geht natürlich nicht an, ihn am Ende doch für Deutschland zu reklamieren – das steht niemandem zu, der Deutscher ist – , sondern darum zu zeigen, daß das Exil etwas so Einschneidendes war, daß es auch nach fast 50 Jahren – seine Familie verließ Deutschland 1934 – als Konflikt für Peter Weiss noch nicht beendet war: Wenn er sich nicht als Deutscher fühlen konnte, dann aber auch nicht als Schwede. Nach eigenem Bekunden hat er schon in den sechziger Jahren daran gedacht, nach Berlin zu ziehen; Anfang 1982 machte er Anstalten, seinen Wohnsitz zu verlegen; jedenfalls für einen Teil des Jahres wollte er fortan in Berlin leben. Er besichtigte Wohnungen, fand eine große Berliner Wohnung in der Potsdamer Straße – sogar (was er sich immer gewünscht hatte) mit einem versteckten Raum, der nur durch eine gut getarnte Tapetentür erreichbar war! Er war begeistert von der Wohnung und von der Adresse Potsdamer Straße 55, da hier in der Nähe auch die schwedische Schriftstellerin Karin Boye einst gewohnt hatte. Es ist Weiss dann aber aus familiären Gründen nicht gelungen, den Schritt der Rückkehr aus Skandinavien zu vollziehen, den 36 Jahre früher, 1946, ein anderer Exilant aus Skandinavien vollzogen hatte, der nach Berlin ging und dort blieb: Willy Brandt. Mir scheint, daß der Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ das künstlerische Pendant ist zu jenem Kniefall Willy Brandts vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Keiner, der nur Deutscher ist, konnte das offenbar fertigbringen. Um noch einmal auf Namen zu kommen: Willy Brandt hat den Namen behalten, unter dem er im Exil seine Identität erwarb. Er war nicht mehr Herbert Frahm, er war Willy Brandt.
Peter Weiss’ Roman wird, so habe ich den Eindruck, im Moment nicht sehr viel gelesen. Das hängt wohl zum einen mit dem sperrig-abstrakten Titel des Werks zusammen, zum anderen sicher ganz einfach mit seinem Umfang, der keine lockere und bald wieder beendbare Lektüre zuzulassen scheint, und drittens wirkt die – sagen wir einmal: Thematik des Buches, oder besser: die Thematiken nicht gerade aktuell, fast ‚outdated‘: Das Ende der deutschen Arbeiterbewegung durch Nazi-Herrschaft, Krieg und Stalinismus; die ideologischen Kämpfe innerhalb des Kommunismus in den dreißiger und vierziger Jahren, die Auseinandersetzungen mit der Avantgarde-Kunst des 20. Jahrhunderts, welche den parteioffiziellen stalinistischen Kunstdoktrinen nicht zu paß kam und die Weiss zu verteidigen, fast muß man sagen: zu versöhnen versucht zu einem Zeitpunkt als diese stalinistische bzw. realsozialistische Bevormundung durch Parteibürokraten für die westlichen Künstler gar kein Problem mehr war – diese Thematiken der Vergangenheit scheinen das Buch historisch zu machen, lassen es jedenfalls, auch bei der intellektuellen Linken (falls es so etwas in der Bundesrepublik noch gibt) nicht mehr so brennend aktuell erscheinen. Es nimmt dem Buch aber nichts von seiner Größe, da inzwischen, entgegen der Sorge von Peter Weiss in den siebziger Jahren, wohl doch im historischen öffentlichen Bewußtsein der Bundesrepublik „Erinnerung“ gestiftet ist – nicht zuletzt auch durch die Werke und öffentlichen Interventionen von Peter Weiss, eine „Erinnerung“, die stabil zu sein scheint. Das jene Kraft des Lesens, welche nötig ist zu einigermaßen konsistenter Lektüre von 1000 Seiten deutscher Prosa vielleicht allgemein nachgelassen hat, ist gewiß nicht Peter Weiss anzurechnen oder vorzuwerfen. Es wäre nicht das schlimmste, wenn die „Ästhetik des Widerstand“ so gelesen würde wie Marcel Prousts Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, den ja wohl auch nur wenige Leser ganz gelesen haben. Aber große Bücher sind halt auch Steinbrüche.
Anmerkungen
1 Peter Weiss: Fluchtpunkt. Roman. Frankfurt/Main 1983, S. 59.
2 Fluchtpunkt, S. 137.
3 Peter Weiss’ „Die Ästhetik des Widerstands. Roman“ wird zitiert nach der Ausgabe der drei Teile in einem Band, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1983. – Der Text ist seiten- und zeilenidentisch mit dem der Erstausgaben von 1975, 1978 und 1982.
4 Die Zeit, 17. 12. 1971.
5 Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werkle. Band 2, . Stuttgart 1961, S. 204.
6 Ebd., S, 204.
7 Ebd. S. 207
8 Ebd., S. 206.
9 Peter Weiss unter dem Pseudonym Sinclar: Der Fremde. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1980, S 81. (= edition suhrkamp 1007.)
10 In Hölderlins „Mnemosyne“ wird am Ende in klagendem Ton eine weitere Gruppe von drei Helden genannt: Achilles, Ajax und Patroklos – vielleicht ist dies die älteste mythisch-historische Folie für die drei proletarischen Widerstandskämpfer Heilmann, Coppi und den Erzähler.
11 Dante, Divina Commedia, Inferno, 3. Gesang, Zeile 9.
12 Klaus Stiller, „H. Protokoll“. Berlin/ Neuwied:Luchterhand 1970.
13 Sigmund Freud: Gesammelte Werke IX.. 5. Auflage. Frankfurt/Main: S. Fischer 1973, S. 97.
14 Guido Ceronetti. Das Schweigen des Körpers. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1983, S. 171.
15 Notizbücher, 2. Band, S. 898 – 925.
16 Notizbücher, 2. Band, S. …. (nachschauen!)
17 Notizbücher, 2. Band, S. 645.
Jörg Drews: Den Namenlosen einen Namen geben. Peter Weiss’ Projekt einer Ästhetik des Widerstands. Ein Radioessay. In: Bayerischer Rundfunk, 2. Programm, 2. März 2007, 22.05 bis 23.00 Uhr. Veröffentlicht in: Hörspiel. Autorengespräche und Porträts. Hg. von Katarina Agathos / Herbert Kapfer. Edition BR radiobuch. Belleville Verlag, München 2009, S. 235 – 258. (Manuskriptfassung)