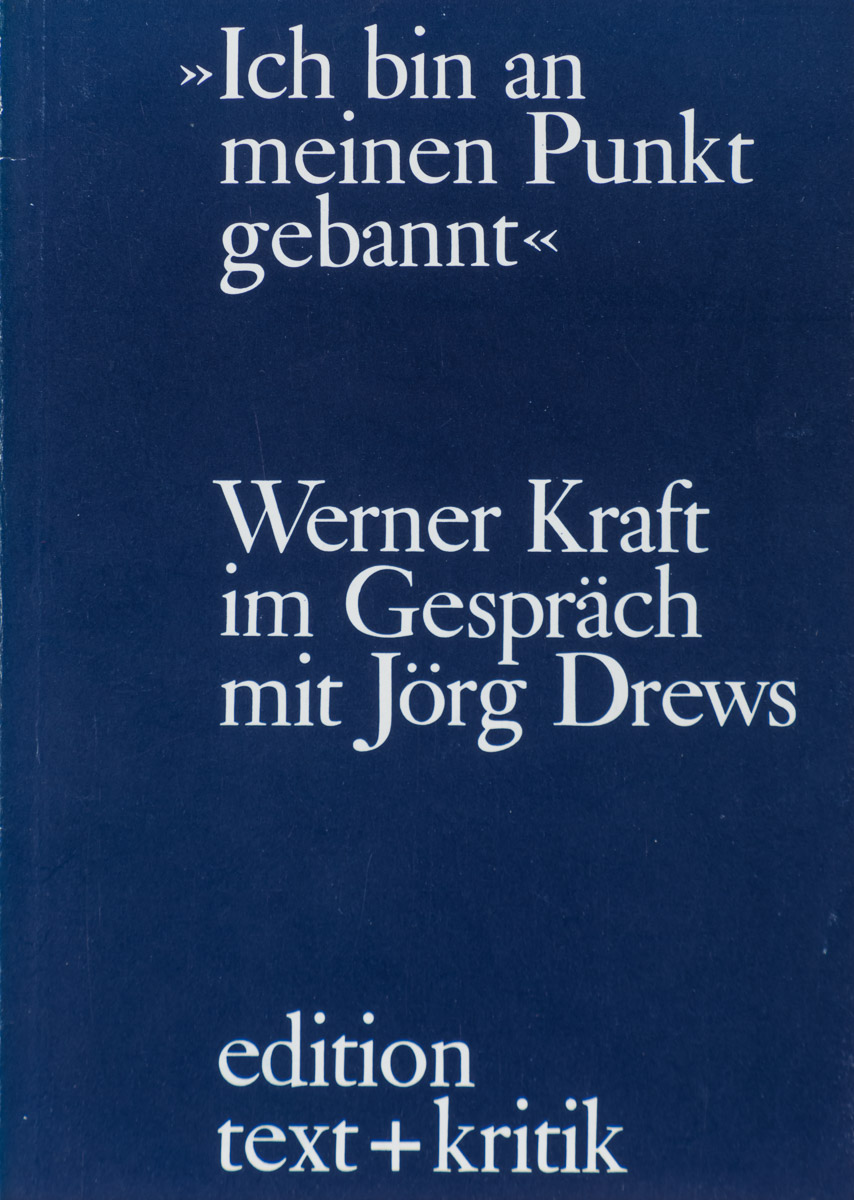Jörg Drews: Heinrich Heine in den Augen Werner Krafts
Einer, der an Palästina wohl kaum je gedacht hat, sitzt nun, seit dem Spätsommer 1934 und bis zum Ende seines Lebens 1991, weil das „Gesetz über die Wiederherstellung des deutschen Berufsbeamtentums“ vom 8. April 1933 es so will, in eben diesem Palästina, ein Bibliothekar in Hannover mit einer Lebenszeitstellung, die schon fünf Jahren nach der Anstellung endet. Die erste Arbeit Werner Krafts in Jerusalem ist ein Nachwort zu einer kleinen Auswahl von Schriften Heinrich Heines als Nummer 57 der „Bücherei des Schocken-Verlags“, jenes Heine, bei dem Palästina zwar häufig vorkommt, der sich aber bis zu seinem Ende nicht – metaphorisch gesprochen – eindeutig für Palästina, also sein Judentum – was immer das konkret bedeuten sollte oder hätte bedeuten sollen – entscheiden konnte, und zwar endlich sein „Halleluja“ sang, aber weder Rebe noch Priester, weder „Kadosh“ noch christliches Gebet an seinem Grab wollte.
Werner Kraft trifft diese Auswahl von Heine-Texten und verfaßt das Nachwort dazu im Jahr 1935/1936; es ist 1936 mit einem Umfang von 88 Seiten unter dem Titel „Heine“ in Berlin erschienen, wo der Schocken-Verlag noch publizieren durfte. Das Bändchen ist so schmal, als sei es schon im Hinblick darauf bemessen, daß man es als Fluchtgepäck wohin auch immer noch würde mitnehmen können. Ein weiteres Mal schrieb Kraft dann in den siebziger Jahren in Jerusalem über Heine in einer Reihe von 30 kommentierenden Kurzessays zu Gedichten Heines unter dem Titel „Heine der Dichter“; der Band erschien 1983.1 Wichtig ist, daß Kraft gleich im Titel akzentuiert, daß er nicht über den Prosaisten Heine schreibt, den Reiseschriftsteller, Kulturkorrespondenten und kulturhistorischen Essayisten, sondern über den „Dichter“. Kraft versucht eine ‚Rettung’ des Lyrikers Heine in einer Art unbehaglichen Widerspruchs zu der Vernichtung Heines als Lyriker durch Karl Kraus in der Polemik „Heine und die Folgen“ von 1910, in der Karl Kraus dekretiert hatte: „Heinrich Heine, der Dichter, lebt nur als eine konservierte Jugendliebe. Keine ist revisionsbedürftiger als diese.“ 2
Da nun wiederum Karl Kraus für Kraft sein Leben lang eine kaum zu bezweifelnde Instanz war und ihn, Kraft, in seiner Jugend „gerettet“ hatte „vor George und vor Borchardt“3 , also davor, in Idolatrie vor Borchardt und in den Bann und unter das Charisma Georges zu geraten, diesen zu „verfallen“, steht Kraft nun sowohl 1935/36 wie auch in den folgenden Jahren, als er die kleinen Essays schreibt, die 1983 zusammen als „Heine der Dichter“ erscheinen, vor der Notwendigkeit, irgendwie ‚zurechtzukommen’ mit bzw. herumzukommen um Karl Kraus’ Verdikt in „Heine und die Folgen“, welches das ganze „Buch der Lieder“ verwirft, auf welche Periode sich auch der im Ton Karl Kraus ganz ähnliche schneidende Satz Varnhagen von Enses aus einem Brief an Rahel Varnhagen bezieht, den Kraft sowohl 1936 wie auch – mit einer leisen ‚Variation – 1983 zitiert: „Heines Leben fehlt der Wahrheitsgrund.“4 Und wenn Kraft an anderer Stelle eine Äußerung Mörikes über Heine zitiert, die von atemberaubender Zwiespältigkeit und erschreckend zärtlich zugleich ist, nämlich: „Er ist ein Dichter ganz und gar, aber nit eine Viertelstund’ könnt ich mit ihm leben, wegen der Lüge seines ganzen Wesens“5, so ist ja nicht zu vermuten, daß Kraft Varnhagen und Mörike unterstellt, diese urteilten aus antisemitischer Ranküne.
Aber die beiden Urteile konvergieren mit dem schneidenden Urteil von Karl Kraus über Heine, geschrieben in einer Prosa, deren Schärfe Kraus aus der Überwindung der Mehrdeutigkeiten und des unernsten und großspurigen Manövrierens eben von Heinrich Heine und Maximilian Harden gewann. So steht Kraft zunächst mit Kraus gegen Heine, und zwar nicht aus charakterlich-moralischen Gründen, sondern aus Gründen der dichterischen Moral. Von Heine dem Dichter aber – und hier versucht er sich von Kraus zu lösen –geht für Kraft der Appell aus, Heine tiefer zu verstehen, das heißt einzelne Gedichte vor dem Pauschalurteil Kraus’ über Heine zu retten, sie von dem Verdikt Kraus’ begründet auszunehmen. Eine solche unbedingte Ausnahme ist für Kraft das erste der ergänzenden Gedichte der Gruppe „Zum Lazarus“, von Kraft erörtert und zitiert in einem Kurzessay unter der Überschrift „Die Hiobsfrage“:
Laß die heiligen Parabolden,
Laß die frommen Hypothesen –
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweif uns zu lösen.
Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem Roß der Schlechte?
Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.
Also fragen wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler –
Aber ist das eine Antwort?6
Und ein zweites der Gedichte Heines, von denen Kraft ohne Vorbehalt positiv spricht, ist ein Fragment aus dem Nachlaß, das Kraft zufolge zuerst Alfred Meißner aus dem Nachlaß mitgeteilt hat, das Kraft aber als ein ganzes Gedicht und keineswegs nur als „Fragment“ gelten lassen will – obwohl es, philologisch gesehen, wohl doch nur ein Bruchstück aus einem nicht vollendeten umfangreicheren Gedicht ist – und das er als ein dem Gedankengang und dem großen Ernst nach vollendetes Poem nimmt:
Gott gab uns nur einen Mund,
Weil zwei Mäuler ungesund;
Mit dem einen Maule schon
Schwätzt zuviel der Erdensohn!
Hat er jetzt das Maul voll Brei,
Muß er schweigen unterdessen;
Hätte er der Mäuler zwei,
Löge er sogar beim Fressen.7
Das Erschütternde, sagt Kraft kommentierend, sei die Wucht der Betonung auf dem Wort bzw. der Verbform „löge“. In gewissem Sinne ist nun dieses Fragment bzw. das darin enthaltene Argument ja ebenfalls ein Witz, denn Heine verfolgt in dem Gedicht den Gedankengang oder die Pseudofrage, warum denn der Mensch als Geschöpf Gottes zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher, aber nur einen Mund habe und kommt dann zu der abgründigen Diagnose, daß der Mensch nur einen Mund habe, um seine unausrottbare Neigung zur Lüge wenigstens ein bißchen in Zaum halten zu müssen. Aber die Verhöhnung der physikotheologisches Beweisführung für den Menschen als ein durchdachtes und geglücktes Stück Schöpfung erfolgt mit einem kalten anthropologischen oder eher: misanthropischen Ernst, der Witz ist souverän bitter und gewissermaßen echt, massiv und ganz unbeliebig.
Die – vor hundert Jahren oft gestellte – Frage nach dem „Charakter“ Heines mitsamt der impliziten oder expliziten Standard-Antwort ist nicht zuletzt kaum mehr möglich, weil sie in Deutschland sich unweigerlich vermengen würde mit den bekannten antisemitischen Heine-Stereotypen. Werner Kraft als Jude aber kann es sich leisten auszusprechen, dass – wie er im Gefolge Karl Kraus’ meint – Heine als Dichter ein großes Talent war, mehr aber nicht, weil ihn sein schlechter Charakter daran hinderte; nach Krafts Meinung war Heine der Dichter eher „ein Talent, weil kein Charakter“. Kraft ist ein Moralist, aber ein Moralist, der nicht nach Heines Lebenswandel fragt, sondern gewissermaßen nnach dem poetischen ‚Charakter’ Heines, nämlich wie oft oder vielleicht sogar wesensmäßig Heine im Dichten die strenge Wahrhaftigkeit um des Effekts, um der ästhetischen, vor allem der witzig-wortspielerischen Pointe, des Effekts willen nicht verraten, aber in die zweite Reihe seiner Erwägungen verwiesen hat. In Heines sündhafter Gewandtheit im Versemachen sieht Kraft ein moralisches Problem oder eben zumindest die Einfallstelle für Unechtes, Beliebiges, effektvoll Inszeniertes; vielleicht müßte man diese Gewandtheit eher mit „fatal“ bezeichnen, weil das „sündhaft“ so kunstreligiös getönt ist. Eine ähnliche, wohl unabsichtlich doppeldeutige Variante formulierte Hauschild auf der Tagung in Graz und meinte dabei positiv, was Kraus und Kraft negativ meinen und wozu sie nur sarkastisch nicken könnten: Kraus habe „die deutsche lyrische Sprache erleichtert.“ 8 Gemeint ist sicher und zu Recht, daß Heine der deutschen Sprache und vor allem der lyrischen Sprache die Fähigkeit zu urbanem Witz erwarb und zu ironischer Selbstdistanzierung, den Gestus des Einbekennens von Sentimentalität, aber dies „erleichtern“ hatte Kraus allerdings bekanntlich eben so ausgelegt, als habe Heine aus der deutschen Sprache ein wahrhaft „leichtes“ Mädchen gemacht, dem nun jeder lyrische Kommis am Mieder fingern dürfe …
Und ließ Heinrich Heine sich denn wirklich nie „merkantilisch“ einspannen? Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, denn daß sogar Liebesgeschichten – und erst recht unglückliche, dann aber witzig in Versform gebrachte – in „merkantilische“ Zusammenhänge hineinreichen, ja zwecks Absatzsteigerung hineinzureichen geradezu gemeint waren, notiert ja auch Heine selbst öfters, bekennt es ein und schockiert damit den ‚romantischen’ Leser. Das hat ein Parodist des frühen 19. Jahrhunderts präzise aufgespießt: Er läßt den liebesbekümmerten Dichter Heine sogar der ihn Verletzenden noch dankbar sein, weil er, was er an ihm angetanem Leid beschrieben und „geschrieben hat unter der Lampe“, demnächst ganz cool veröffentlichen kann „in Kleinoktav bei Hoffmann und Campe“, und dies gewiß noch, mit durchaus Heineschem Spott geäußert, mit dem gewünschten Haupt- oder Nebeneffekt auf seine Börse – also von wegen sich „merkantilisch nicht einspannen“ lassen! Die Zeitgenossen jedenfalls sahen ihn durchaus –amüsiert oder böse – am Kummer vorbei auf das Autorenhonorar bzw. den Absatz schielen:
Den Gärtner nährt sein Spaten,
Den Bettler sein lahmes Bein,
Den Wechsler seine Dukaten,
Mich meine Liebespein.
Drum bin ich dir sehr verbunden,
Mein Kind, für dein treulos Herz;
Viel Gold hab’ ich gefunden
Und Ruhm im Liebesschmerz.
Nun sing ich bei nächt’ger Lampe
Den Jammer, der mich traf;
Er kommt bei Hoffmann und Campe
Heraus in Klein-Oktav.9
Eigentlich notiert Heine selbst ja an solcherlei Stellen nur sowohl romantisch-ironisch und modern zugleich das uralte Paradox, daß Kunst sich aus Allerprivatestem speist, der Autor dies dann aber sofort im wahrsten Sinne des Wortes veräußerlicht, nämlich – da ja auch der Dichter leben muß – es veräußert. Daß aber Heine ganz offen darüber spricht und desillusionierend solche Zusammenhänge einbekennt, also mit der deutsch-romantischen Innerlichkeit frivol umgeht, das hielt Kraft für eine von ihm leicht mißbilligte Art von Witzigkeit und zitierte die obige Stelle auch nur im Gespräch, nahm den Text aber nicht in seine Überlegungen im Buch „Heine der Dichter“ auf. Das deutschsprachige Publikum aber nahm Heinrich Heine soweit wie bekannt durchaus übel, an seiner Spitze dann und wortmächtig Karl Kraus, der zusah, wie aus sprachlichen „Wundern“ ein kontinuierlicher „Zauber“ und zwar im Sinne von einem ‚faulen Zauber’ wurde: „Heine hat aus dem Wunder der sprachlichen Schöpfung einen Zauber gemacht.“10 Doch wie weit Kraft auch diesem Urteil Kraus’ folgt, so folgt er Kraus doch aber auch, indem er große Ausnahmen statuiert; Krafts ganzes Buch „Heine der Dichter“ kann man ernsthaft und zugleich leicht erheitert lesen als Ergebnis der Bemühung, der seltsam versteckten Bemerkung Kraus’ in „Heine und die Folgen“ zu folgen, um „ein Echtes“ zu finden, das ja auch Kraus als Möglichkeit Heines einräumt: „Der Tod ist ein noch besserer Helfer als Paris; der Tod in Paris, Schmerzen und Heimatsucht, die bringen schon ein Echtes fertig (…) Das ist andere Lyrik, als jene, deren Erfolg in den Geschäftsbüchern ausgewiesen steht. Denn Heines Wirkung ist das Buch der Lieder und nicht der Romanzero, und will man seine Früchte an ihm erkennen, so muß man jenes aufschlagen und nicht diesen.“11
„Einwände gegen Heine kommen heute offenbar nur noch aus der Kraus-Richtung“, resümierte Jan-Christoph Hauschild in seinem Referat „Heine-Kritiker, Heine-Verächter. Ein kurzer Rückblick“ auf der Grazer Tagung vom Sommer 2006. Das kommt aber – falls es stimmt – wohl nicht nur daher, daß literarischer Antisemitismus (falls es den überhaupt noch gibt) nicht mehr wagt, seine Stimme zu erheben, sondern eher daher, daß die Kategorien „echt“, „authentisch“, „wahrhaftig“, „nicht nur gespielt, sondern wirklich gefühlt“ usw. so viel schwächer geworden sind. Wir haben inzwischen wohl das Inszenierte aller Literatur viel präziser wahrzunehmen und vorauszusetzen gelernt und sind mit Zuweisungen wie „echt/authentisch“ (versus unecht, ironisch, gebrochen, nur spielerisch usw.) vorsichtiger , so daß also wir auch schon die romantische Lyrik für ‚inszeniert’ halten dürfen. Und derjenige, der uns auf diesen Verdacht bringt bzw. diese ambigue Stimmung in der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert einführte, war zwar Heine, aber gerade darin sprach er – um es mit Kraft zu formulieren – ja Wahrheit, und dies hing wohl nicht von seinem „schlechten Charakter“ o.ä. ab. Vielmehr war diese Destruktion des spätromantisch Unechten etwas epochal und historisch-überpersönlich Notwendiges: Eine ihrerseits unehrliche, ‚inszenierte’ Stimmung war zu kassieren, die Romantik und der hohe Ton generell eben seiner Inszenierbarkeit zu überführen. Für uns Leser zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind aber solche Kategorien wie Authentizität nicht mehr so eindeutig, das einbekannte Inszenieren von Gefühlen nicht unbedingt lyrisch unmöglich und lasterhaft – wie unterscheidet man im übrigen das „echte“ „Echte“ vom „unechten“, nur inszenierten „Echten“? – , und die Heine’sche Ironie, die bis vor etwa 60 Jahren verbreitet als so degoutant galt, ist innerhalb des literarischen Sprechens generell nicht mehr problematisch, wo – teilweise schon von Gottfried Benn an, sicher aber seit Tucholsky, Rühmkorf, Wolf Biermann und Robert Gernhardt der urban-wortspielerische großstädtische Bardenwitz in der deutschen Lyrik Bürgerrecht hat, so sehr, daß gerade die Gedichte Biermanns und vor allem Gernhardts einem Großteil der literarischen Öffentlichkeit im Moment ja als Inbegriff der Lyrik gelten, und zwar im Sinne einer ach so verbraucherfreundlich ‚erleichterten’ Lyrik: Da sieht man’s ja, so locker geht’s doch auch, warum denn also die Verstiegenheiten des Hohen oder gar Experimentellen im Gedicht?
Dies kann man als Ausdruckssituation zurückdenken aufs frühe 19. Jahrhundert, also auf den historischen Moment des Verblassens der in die Ferne rückenden Sprachhöhe Goethes, Hölderlins und der großen Romantiker: Werner Kraft sieht – obwohl selbst gewiß ein Literaturkonservativer – bei aller auch schlecht ‚erleichterten’, veralltäglichten Lyrik nach der Klassik und Romantik aber doch genau, daß der „Sturz von der Sprachhöhe Goethes im problematischen aber historisch notwendigen Fortschreiten der Epoche dem Fortschritt den stärksten Anstoß gibt.“12 oder, wie es in einer Tagebuch-Aufzeichnung Krafts vom 28. 12. 1958 heißt: „Das größte Beispiel individueller Sprache, die die Traditionsbildung erschwert – oder die falsche begünstigt – ist die Sprache des alten Goethe, die höchste Individualsprache, die wir kennen, die aber der deutschen Sprache nach Goethe, um mit diesem Koloß fertigzuwerden, nur zu ‚sinken’ erlaubt, wofür das logisch folgerichtige Beispiel Heine ist … .“13 Es ist dies ‚Sinken’, das synonym ist mit Öffnung, mit Öffnung des Gedichts für Töne und Inhalte, die vorher ausgeschlossen waren, und dies ist auch etwa für Helmut Heissenbüttel in seinem Essay „Was alles Platz hat in einem Gedicht“14 der Grund dafür, als den für die Fortentwicklung der deutschen Lyrik folgenreicheren Autor Heine zu benennen und nicht etwa Eduard Mörike. Schon in einem frühen Stadium der Beschäftigung mit Heine, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Zusammenstellung der dann 1936 erscheinenden Textauswahl notierte Kraft in einem Brief vom 31. 12. 1934: „Ich lese jetzt sehr intensiv Heines Gedichte. Es ist nicht der größte deutsche Lyriker des 19. Jh. – im Vergleich zu Eichendorff, Keller, Mörike – aber sicher der notwendigste.“15 Kurze Zeit später, am 26. 2. 1935, heißt es in einem Brief, wiederum an Wilhelm Lehmann: „Ich lese jetzt viel Heine. Von allen paradoxen Künstlergestalten die paradoxeste. Die furchtbarsten Gegensätze nicht nur im Leben sondern auch in der Kunst! Der widerlichste Journalismus neben der reinsten Lyrik, und eben wegen Umfang und Spannungskraft war er doch größer als Eichendorff oder Mörike, die, praktisch, in Hinsicht der Kunstleistung größer sind als er. Das Gedicht „Morphine“ finde ich erhaben.“16. Zehn Monate später ist sein Urteil noch viel emphatisch-positiver geworden: „… vorwiegend habe ich mich in der letzten Zeit mit Heine beschäftigt, und es geht mir langsam auf, daß er in seinen enormen moralischen und geistigen Schwächen die entscheidendste Dichterpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts gewesen ist, im ganzen von wahrhaft providentieller Bedeutung.“, und er fährt fort, Heine habe in seinen späten Gedichten deren Schönheit „dem Schein in die Sphäre der Wahrheit entrissen“ durch den „mächtigen Wahrheitsmut dieses Mannes“17 – dieses Mannes Heine. In höchste Sphären europäischer Geistesentwicklung, nämlich in den beginnenden Nihilismus nach dem Verlust alles Vertrauens in Gott und die Schöpfung und den möglichen Gang der Weltgeschichte stellt Kraft dann schließlich Heine im Nachwort zu dem Schocken-Bändchen von 1936; dort heißt es, daß beispielsweise Rudolf Borchardts geringe Schätzung Heines auf einem Fehlurteil beruhe und gerade Borchardt scharfer Blick ihn eigentlich zu einer Einschätzung hätte führen müssen, in welcher der geradezu „providentielle Charakter dieser Gestalt“(scil.: Heines) sich ausdrückte, „nicht anders als bei Baudelaire, Dostojewski oder Kafka und allen, die ohne es zu wollen, durch den Vorhang der Erkenntnis sehen müssen, wo ihnen das nackte Grauen entgegenstarrt“.18 Damit wird Heine zu einer ersten und großen Passionsgestalten des europäischen Nihilismus.
Dieses Paradox Heine umkreist Werner Kraft immer wieder, im Tagebuch, in Briefen und Essays; es trieb ihn wohl, wie wir auch Ohne Einsicht in die noch unedierten Tagebücher Werner Krafts vermuten können, bis zu seinem Tode um. Er sieht das Beschädigte Heines, er sieht, daß dieser zwar kein „ganzer“ Mensch mehr ist, „wie der Dichter des 104. Psalms, sondern aus einem Riß entsprungen, zu dem er sich bekennt“, und doch sei „dieser Riß nur wie eine Lücke, die sich schließen kann dank der Begeisterung des Dichters“19 Das ist in keinem Sinne mehr Moralkritik; Heines Zerrissenheit ist keine Privatsache, sondern Kraft sieht sie dezidiert als eine eine Signatur der Epoche wie Heine selbst : „… die Welt selbst ist mitten entzwei gerissen. Durch das meinige (scil. Herz) ging aber der große Weltriß …“20, Kraft stimmt dem verschärfend, wenn auch ‚wissenschaftlich’ wohl ungenügend begründet, zu – aber darf nicht der Essay zu suggerieren und einzukreisen versuchen, was wissenschaftlich nicht recht zu fassen und zu erweisen ist? – , wenn er Heine in seiner Auswahl von 1936 gleich im allerersten Eintrag einen (Geburts-)Platz an einer bedeutsamen Stelle, einer Jahrhundert- und Epochenwende anweist und daraus unausgesprochen die Zerrissenheit Heines ableitet: „Um meine Wiege spielten die letzten Mondlichter des achtzehnten und das erste Morgenrot des neunzehnten Jahrhunderts.“21 Heine ist noch in der ungebrochenen Kunstepoche geboren, aber er wird erwachsen in der Zeit Brechung dieser Epoche, ihrem Abgleiten in die Ironie im „unteren Bereich der Kunst“22, den dann Heine selbst bisweilen tief geschmerzt beklagt, wo nämlich „die armen Nachtigallen,/ um schönen Rosen zu gefallen,/ Sich an den Hals die Schwindsucht singen.“ Bewundernd-verstehender Kommentar Krafts: „Das hätte Goethe nie gesagt, obwohl es vielleicht nur mit einer jenseits von Herz und Geist erstarrten lyrischen Konvention tabula rasa macht.“23 Heine aber sagt das, in jener Welt, die Goethe geahnt, aber nicht mehr erlebt hat und die von ganz neuen und tiefgehenden Vibrationen erschüttert wird, die auch Geist und Poesie neu konditionieren werden. Natürlich muß das hier fällige klassische Zitat auch in Krafts Heine-Auswahl von 1936 auftauchen, wiederum gleich auf der ersten Seite:
Deutschland ist jetzt fortgerissen in die Bewegung, der Gedanke ist nicht mehr uneigennützig, in seine abstrakte Welt stürzt die rohe Tatsache, der Dampfwagen der Eisenbahn gibt uns eine zittrige Gemütserschütterung, wobei kein Lied aufgehen kann, der Kohlendampf verscheucht die Singvögel, und der Gasbeleuchtungsgestank verdirbt die duftige Mondnacht.24
Es fällt übrigens auf, daß bei Werner Kraft neben solchen historisch-poetologischen Spekulationen über Notwendigkeiten der Wandlungen der Poesie sich auch intensive verstechnische Erörterungen finden, Überlegungen zu Reim, Metrum und Zäsuren und das adäquate Sprechen bzw. Skandieren von Versen Heines, also konkrete Untersuchungen auch der handwerklichen und mehr als nur handwerklichen Beschaffenheit vieler Verse bzw. Gedichte Heinrich Heines; gleich das dritte Kapitel in „Heine der Dichter“ heißt lapidar „Die Metrik“. Dies sind Aspekte, die heutige Leser und sogar heutige Germanisten beschämend wenig zu interessieren scheinen, während Kraft genau durch solche detaillierten Erörterungen auch die Verse und Verstechnik Heines ganz konkret in den Stand der Verssprache Goethes und Wilhelm Müllers, Immermanns, Freiligraths und Rückerts einzubetten weiß.
Und schließlich fällt auch auf, wie grundsätzlich emphatisch – heute müßte man fast sagen: nachhaltig emphatisch – Werner Kraft über den Dichter Heinrich Heine spricht. Es gibt bei Kraft einen Ernst, ein Ernstnehmen der Dichtung, das vom Furor von Karl Kraus ebenso weit entfernt ist wie von der aus Gründen der Wissenschaftlichkeit des Tons gedämpften Diktion germanistischer Heine-Darstellungen. Werner Kraft hat eine Fähigkeit und Neigung zu Bewunderung und Verehrung, der er mehr Ausdruck geben darf als die meisten Germanisten, da er nicht universitär eingebunden war. Diese Neigung zur Verehrung in seinen Büchern über Goethe und Seume, über Jochmann und Hofmannsthal hängt zusammen mit seiner Überzeugung, daß es eben doch große Einzelne , auch große Autoren gebe und daß diese auch emphatisch ausgesprochen werden dürfe. Daher dann auch Krafts Neigung zur Verzeihung, zur Rettung, zu nur geradezu irritierend schonender, gedämpfter Kritik – statt Kraus’scher totaler Verwerfung – in Aufsätzen und Monographien, beispielsweise im Buch über Stefan George von 1980. Im Fall Heine bedeutet dies, daß Krafts Moralismus sich, wie gesagt, nicht um Heines Lebensführung kümmert, sondern eher nach der Moral seines Künstlertums fragt und akzeptiert, daß bei Heinrich Heine in Anschlag zu bringen sei, daß er als einer der ersten Krisenerfahrungen machen mußte, die nicht zuletzt mit den Modernisierungsprozessen um 1800 zusammenhängen, und daß diese Erfahrungen auch Heines komplexe Beziehung zum Judentum einschließen. Nobel läßt Kraft im Ungewissen, wie denn genau das Verhältnis zwischen der Moralität des Dichters als Person und der Moralität seiner Dichtungen – fragte man denn danach – zu definieren sei; deutlich ist ihm, daß eines mit dem andern nicht direkt verrechenbar ist, also jedenfalls schon aus methodischen Gründen Diskretion angezeigt sei und es – pathetisch gesagt: – ein Wunder bleibt, daß aus der moralischen Gebrechlichkeit der Person dennoch strenge geistige Gebilde hervorgehen können. Die folgenden Zeilen aus der Einleitung von Krafts Anthologie „Wiederfinden“ könnten auf Heine gemünzt sein;
Jedes Kunstwerk hat, wie Novalis will, eine apriorische Notwendigkeit, da zu sein. Es ist zweifelhaft, ob jeder Dichter sie hat, selbst der große. Alles Menschliche steht im Dunkel des Nichtwissens, alle Kunst entwirft Möglichkeiten des Menschlichen, an welchen sich eine persönliche Existenz aufbauen kann, um aus ihrem nötigen Dunkel in den geistigen Lichtglanz der Kunst durchzubrechen, welche der Dunkel der Person nicht durchbricht.25
1936 wollte Werner Kraft in seiner Heine-Auswahl ein „konzentriertes Bild des Mannes geben, dessen Geist seit hundert Jahren unfeststellbar unter uns weilt“ 26, und es ist wohl diese ‚Unfeststellbarkeit’, dies nicht Festzulegenden an Heinrich Heine und seine, Krafts, eigene zwiespältige Haltung zu ihm, die ihn immer wieder über Heine nachzudenken treibt, der sich sehr entzieht, der so uneindeutig ist und unecht oft scheint, der in Vers und Prosa so leichtfertig und so bewegend sein kann und jedenfalls von fataler Wirkung war – alles das, was Karl Kraus zu einer fast gänzlichen Verwerfung Heines brachte und was Adorno als die „Wunde Heine“ in seinem berühmten Essay benannte.
Eine „Wunde“ allerdings scheint Heine nun, nach den Erörterungen zu seinem 150. Todestag im Jahr 2006 in der deutschsprachigen Presse zu urteilen, nicht mehr zu sein. Für Werner Kraft allerdings mit seinem emphatischen Kunst- und Dichtungsbegriff war diese ‚Wunde’ immer noch offen, ähnlich wie für Adorno. Die Summe hieß für Kraft 1936: „Der widerlichste Journalismus neben der reinsten Lyrik.“27 Die Liebe für Heine, die Kraft sich dennoch erhält und die vor allem aus dem Buch von 1983 so stark spricht, hat wohl auch damit zu tun, daß er, nun selbst ein Exilant und deutscher Dichter , über einen anderen Exilanten und deutschen Dichter spricht und Deutschland sie nun beide verstoßen hat.– „In der Fremde“ heißen die drei Gedichte, von welchen dieses das letzte ist:
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft:
Es war ein Traum.
Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch
(man glaubt es kaum,
Wie gut es klang) das Wort: „Ich liebe dich!“
Es war ein Traum.28
Anmerkungen
1 Werner Kraft: Heine der Dichter. München: edition text + kritik 1983.
2 Karl Kraus: Heine und die Folgen. In: Karl Kraus: Untergang der Welt durch schwarze Magie. Schriften Band 4, Frankfurt/Main 1989, S. 185 – 210. (= suhrkamp taschenbuch 1314.)
3 Werner Kraft: Spiegelung der Jugend. Mit einem Nachwort von Jörg Drews. Frankfurt/Main 1995, S. 131. (= Fischer Taschenbuch 12723.)
4 Zitiert bei Werner Kraft aus einem Brief Varnhagens an Rahel Varnhagen, „Heine. Gedicht und Gedanke“, Berlin 1936, S. 82, und „Heine der Dichter“, München 1983, S.12.
5 Eduard Mörike, zitiert bei Kraft, „Heine der Dichter“, S. 62.
6 Zitiert bei Kraft, „Heine der Dichter“, Abschnitt „Die Hiobsfrage“, S. 77 – 81, hier S. 78.
7 Zitiert bei Kraft in „Heine der Dichter“ als „Fragment“ in dem Abschnitt „Die Lüge“, S. 61 – 63, hier S. 63. Merkwürdigerweise zitiert Kraft den Text ungenau; das Bruchstück, das Kraft aber mit einem gewissen Recht als ‚vollendetes’ Gedicht behandelt, lautet in der Düsseldorfer Heine-Ausgabe: „Gott gab uns nur einen Mund, / Weil zwey Mäuler ungesund. / Mit dem einen Maule schon / Schwätzt zu viel der Erdensohn. / Wenn er doppeltmäulig wär / Fräß und lög’ er auch noch mehr. / Hat er jetzt das Maul voll Brey / Muß er schweigen unterdessen, / Hätt’ er aber Mäuler zwey /Löge er sogar beim Fressen.“ (DHA 3/1, S. 401.)
8 Im Gespräch.
9 Ein Beleg für die Macht der treffenden Parodie: Ich kannte die Verse auswendig, hielt sie bisher für von Heine selbst – und muß gestehen, daß sie bei näherer Nachforschung zunächst nicht zu finden waren. Es handelt sich um eine zielsichere Parodie aus dem 19. Jahrhundert, das Heinrich-Heine-Institut Düsseldorf (Bernd Füllner) half sie mir finden; Autor der witzigen wie auch vielleicht schon ressentimentgeladenen Verse ist Wilhelm Neumann (1781 – 1834).
10 Karl Kraus, „Heine und die Folgen“, wie oben, S. 210.
11 Karl Kraus, zitiert bei Kraft, „Heine der Dichter“, S. 102.
12 „Heine. Gedicht und Gedanke“, S. 82.
13 Auszüge aus den Briefen Werner Krafts wurden uns mitgeteilt aus dem Nachlaß Krafts. Wir danken dem Werner-Kraft –Archiv, Hombroich/Niederrhein.
14 Helmut Heissenbüttel: Was alles Platz hat in einem Gedicht. Itzehoe: Hansen & Hansen 1981, S. 11.
15 An Wilhelm Lehmann, 31. 12. 1934.
16 Brief an Wilhelm Lehmann, 26. 2. 1935.
17 Brief an Wilhelm Lehmann, 23. 12. 1935.
18 Kraft, Nachwort zu „Heine. Gedicht und Gedanke“. Berlin 1936, S. 80.
19 Kraft,„Heine der Dichter“, S. 164.
20 Zitiert bei Kraft, „Heine der Dichter, S. 164.
21 Zitiert bei „Heine. Gedicht und Gedanke“, S. 5.
22 „Heine der Dichter“, S. 164.
23 „Heine der Dichter“, S. 164.
24 „Heine. Gedicht und Gedanke“, S. 5.
25 „Wiederfinden. Deutsche Poesie und Prosa. Eine Auswahl von Werner Kraft“. 2. erweiterte Auflage, Heidelberg: Lambert Schneider 1962, S. 10.
26 „Heine. Gedicht und Gedanke“, S. 79.
27 Brief an Wilhelm Lehrmann, 26. 2. 1935.
28 Zitiert bei Kraft, „Heine der Dichter“, Abschnitt „Das Vaterland“, S. 127f.
Jörg Drews: Heinrich Heine in den Augen Werner Krafts In: Harry … Heinrich … Henri … Heine. – Berlin : Erich Schmidt Verlag 2008, 309-318. (Manuskriptfassung)