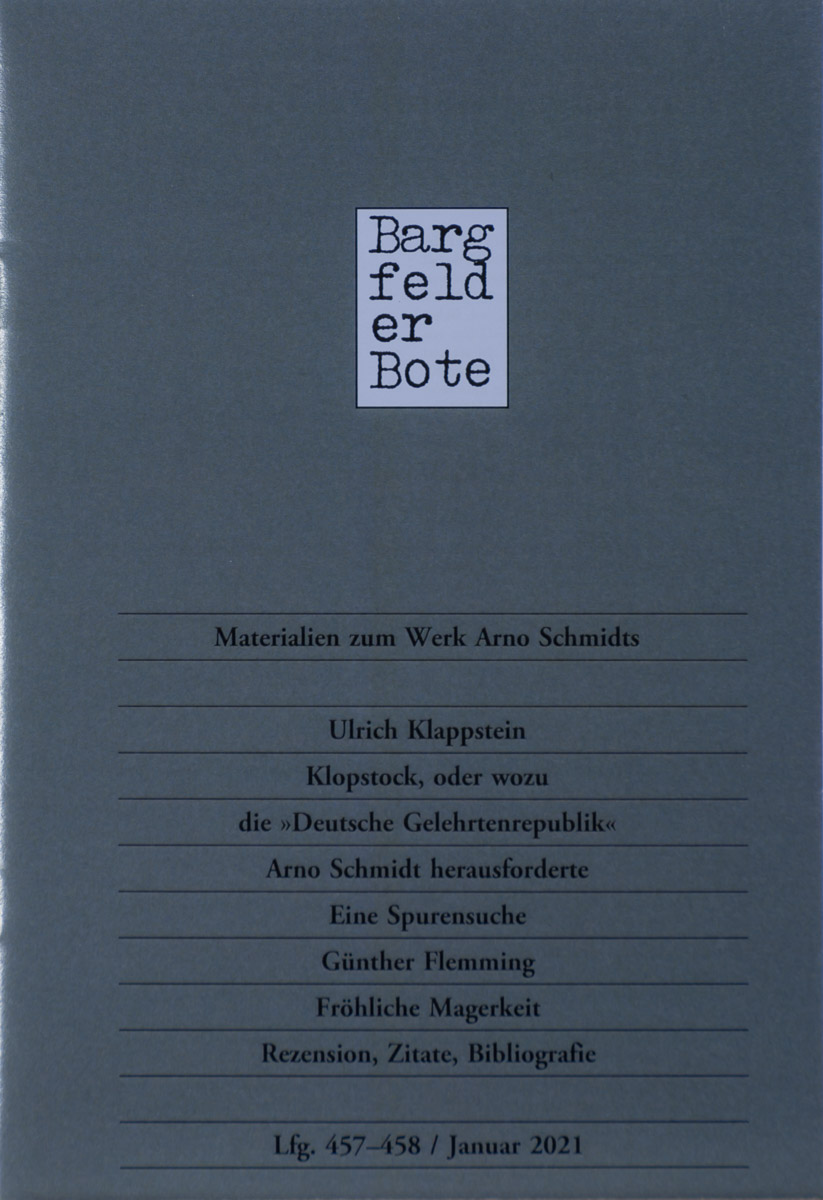Jörg Drews: Nachwort zu „Kosmas oder Vom Berge des Nordens“
Vier Mal hat Arno Schmidt in den vierziger und fünfziger Jahren Erzählungen und Kurzromane in der Antike spielen lassen, und im Fall des hier vorliegenden Kurzromans „Kosmas oder Vom Berge des Nordens“, erstmals veröffentlicht 1955 als Supplementband in der Sonderreihe der einst berühmten Avantgarde-Zeitschrift augenblick, wählte er einen Zeitpunkt, der schon jenseits des Endes des weströmischen Reiches und am Beginn des erstarkenden Ostrom, also der byzantinischen Herrschaft liegt:
Wir schreiben das Jahr 541 nach Christus, Justinian I. herrscht in Byzanz und läßt den später nach ihm benannten Codex des römischen Rechts zusammenstellen; die lateinische Sprache ist also noch vorherrschend, aber der Kaiser ist schon ein gläubiger Christ und hat als solcher im Jahr 529 die als heidnisch geltende Akademie in Athen, diesen Sammelpunkt nichtchristlicher, wahrscheinlich religiös gleichgültiger oder tendenziell agnostischer Intellektueller schließen lassen. Wir können klar erkennen, welches Interesse Schmidt jeweils dahin geführt hatte, historische Erzählungen in die hellenistische Zeit, also in das 4. oder 3. Jahrhundert v. Chr. zu situieren: in „Gadir“ und in „Enthymesis“, beide erstmals 1949 in dem Band „Leviathan“ erschienen, wird dem Forscherdrang des Geographen Pytheas von Massilia und der Menschenflucht des Philostratos von der Staatsmacht bzw. deren Angestellten durch Gefängnis und Ausgrenzung ein Riegel vorgeschoben; einige Jahre später rechnet Schmidt in „Alexander oder Was ist Wahrheit“ (1953) mit der eigenen Alexanderverehrung ab, dekonstruiert das Bild des vom Philosophen Aristoteles angeleiteten Welteroberers und verwandelt es desillusioniert in das eines Tyrannen, der Hitlerische Züge trägt. Zwei Jahre später dann erscheint „Kosmas“, und hier erkennen wir vor allem die fast übermütige Lust Schmidts daran, das alltägliche und das gelehrte Leben der spätesten Antike bzw. des frühesten Mittelalters in einer sehr unwirtlichen, der Hauptstadt Byzanz aber nahen thrakischen Gegend an der Küste des Schwarzen Meeres darzustellen, ja geradezu alles, was er an Wissen zu jener Epoche und Gegend hat, in die Erzählung hineinzupumpen und also auch ein Vokabularium (siehe den Anhang) oder gleich ein ganzes kommentierendes Buch zum Buch zu erzwingen (In christlicher Nacht. Ein Handbuch zu Arno Schmidts „Kosmas“. Hrsg. v. Lothar Meyer. München: edition text + kritik 1989). Auch den wohlwollenden Leser wollte Schmidt offenbar konsternieren, also sich gewissermaßen rabiat und vergnügt präsentieren, und übrigens wollte er wohl auch die Meinung widerlegen, nur in ‚klassischen‘ Zeiträumen der griechischen und römischen Antike, also nur zur Blütezeit Athens, zur Lebenszeit Alexanders oder zur Zeit von Roms klassischer Höhe, seien historische Romane anzusiedeln.
Schmidt hat es sicher genüßlich antizipiert, daß schon 1955 die Kritik und die Leser sich verblüfft fragen würden, wo denn dieses Landgut des Marcellus bzw. Lykophrons überhaupt liegt, und dann Landkarten zu konsultieren hätten: Ist das vielleicht die Gegend, in die 530 Jahre früher Kaiser Augustus den Dichter Ovid hatte verbannen lassen? Und was könnte 1955 (und heute) an dieser unsäglich abgelegenen Landschaft für einen modernen Leser eigentlich interessant oder intellektuell inspirierend seien? Die ersten Rezensionen sprechen deutlich mit kopfschüttelnder Verblüffung von diesem neuen Opus des ‚enfant terrible‘ Arno Schmidt, der schon – seit 1949 – mit drei Büchern zum Teil heftige eindeutige Bewunderung, aber auch erhebliche Irritation hervorgerufen hatte, nicht zuletzt wegen seiner rapiden und gedrängten von Martin Walser und Heinrich Böll bewunderten Sprache und wegen seiner im ängstlichen, auf Konformität bedachten Nachkriegs-Westdeutschland provokativen und mit Furor vorgetragenen Meinung zu diesem und jedem. Und so wurde bei der Veröffentlichung von „Kosmas“ etwas mißmutig die Überladung dieses Prosastücks mit entlegener antiker Gelehrsamkeit bemäkelt, andererseits auch das hübsche Kolorit notiert, das die Erzählung erfrischenderweise doch habe, und die noch Böseren, Humorloseren griffen dann gerne eine Formulierung von Schmidt selbst auf, der einmal einen seiner Protagonisten spotten läßt, Erzählungen Schmidts wirkten wie z.T. „tollgewordene Realenzyklopädien“. Zugleich aber fiel einigen Rezensenten doch auf, daß Schmidt hier wieder in vielen Sätzen an den stilistischen Duktus, die Metaphorik und die Manie zu Wortneubildungen der Expressionisten – zu deren sprachlichen Leistungen sich Schmidt ja immer verehrend bekannt hatte – anknüpfe.
Rückblickend ist es schon erstaunlich, wie seltsam stur und starr die Kritiker meist auf ein Buch reagierten, das doch wenigstens ihre historische Neugierde hätte wecken können, und zweitens ließ oft das Befremden über die Sprache Schmidts die Kritiker übersehen, daß der poetische Furor des Autors hier doch – jenseits befremdlicher Gelehrsamkeit und der zum Teil in der Tradition des Expressionismus stehenden Sprache – sich ganz klar herleitet aus der Frontstellung gegen das Christentum. In den fünfziger Jahren gab es ja die nicht nur in Westdeutschland verbreiteten Versuche, als gemein-westeuropäische neue Ideologie der Bevölkerung und dem geistigen Leben insgesamt die Vorstellung aufzuprägen, der christliche Glaube, insbesondere in seiner katholischen Gestalt, bringe eine neue geistige und geistliche Einigung Europas gegen den Kommunismus zustande, und in ihm stehe ein neuer Halt und eine neue (das heißt: alte) und bewährte Sinnstiftung zur Verfügung, mit der man dem Nihilismus und dem Wertezerfall Einhalt gebieten könne. Gegen dieses sowohl Droh- als auch Wunschbild eines sog. ‚christlichen Abendlandes‘ konnte man schwer offen zu Felde ziehen; die Stimmung war allgemein ängstlich-reaktionär, und (West-) Deutschland war durch die Abtrennung Ostdeutschlands ein wesentlich stärker katholisch geprägtes Land geworden, als es dies vor 1945 bzw. vor 1933, als die protestantische Bevölkerung die Mehrheit hatte, gewesen war. Nicht umsonst machte in den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik der Satz die Runde, der westdeutsche Staat sei in Rom gezeugt und in Washington geboren worden, das heißt: er sei eine reine Zweckgründung und diene amerikanischen Bündnisinteressen und den Interessen an geistlicher bzw. konfessioneller Vorherrschaft Roms. Schmidt war in jenen Jahren außerordentlich alarmiert durch diesen aggressiven Katholizismus, der unter der Vorgabe eines Kampfes gegen den heidnisch-atheistischen Kommunismus seinen Einfluß ausdehnen wollte. Er wußte, wovon er sprach: Von 1951 bis 1955, also auch in der Zeit der Niederschrift von „Kosmas“ (Anfang 1954) lebte er in einer massiv katholischen Gegend südlich von Trier, in Rheinland-Pfalz, und 1955 drohte ihm eine Anzeige wegen angeblicher Gotteslästerung und Pornographie, erstattet von dem Kölner „Volkswartbund“, einer katholischen Sittenüberwachungsorganisation, ein Gerichtsverfahren mit Bezug auf die Erzählung „Seelandschaft mit Pocohontas“, das dann aber von einer vernünftigen Staatsanwaltschaft in Darmstadt im sozialdemokratischen Hessen niedergeschlagen wurde.
Die Story und die Konflikte von „Kosmas“ werden also nicht nur antiquarisch-historisch erzählt, sondern in erkennbarem Zusammenhang mit der um die Mitte der fünfziger Jahre aktuellen Situation. Schmidt, unerschütterlich der Vorstellung vom „Finsteren Mittelalter“ und der Aufklärung verpflichtet, sah das Christentum als kunst- und wissenschaftsfeindlich und intolerant und wählte sich deshalb für seine Erzählung einen historischen Zeitpunkt und Raum, in dem sich ein auf dem Rückzug befindliches antikes Heidentum bedroht fühlte. Man kann gewiß streiten, ob die Verfolgung der Rest-Heiden im östlichen Rom wirklich so bedrohlich und verhetzt war, wie Schmidt dies darstellt; auch die athenische Akademie stand übrigens wohl eher für einen milden Agnostizismus, und ihr Lehrkörper konnte sich nach der Schließung der Akademie erst einmal zwei Jahre Zeit nehmen, sich zu zerstreuen – so lebensgefährlich bedroht waren die Dozenten dann offenbar auch wieder nicht. Aber Sätze wie „Christentum und Kultur?: das ist wie Wasser und Feuer!“ geben der Schmidtschen Erzählung erst Pfeffer, forderten die westdeutschen Intellektuellen zur Identifikation auf und zeigten umgekehrt auch Solidarität mit Hochschullehrern wie etwa Arno Schmidts Freund Max Bense an der Technischen Hochschule in Stuttgart, dem als Professor für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie jahrelang ein Lehrstuhl verweigert wurde, weil er bekennender Atheist war. Schmidt, der in biographischen Angaben zu seiner Person immer wieder durchblicken ließ, er habe an der Universität Breslau zwei Semester Mathematik studiert, und der später in seiner Freizeit an einer Logarithmentafel und als Geodät gearbeitet zu haben behauptete, hatte natürlich Lust daran, sich und Intellektuelle wie Max Bense in der Figur des Mathematikers Eutokios darzustellen und in ihm sein Credo zu Protokoll zu geben, daß nämlich exakte Wissenschaften, Geodäsie und Mathematik die einzigen Bollwerke gegen Aberglauben und Irrationalismus seien. Einen Pfaffen wie Gabriel von Tissoa und einen partiell korrupten Anatolios von Berytos auf die Schippe zu nehmen, den einen als bigotten Intriganten und den anderen als einen, der es sich schon ‚richten‘ wird (aber dann sogar auf die Seite der klaren Vernunft übergeht, wenn es um Gutsbesitz und die glückliche Zukunft seines Töchterchens Agraule geht), setzt einen ja schön ins Recht und gibt einem eine starke moralische Position.
Erfrischend und herzig ist dabei die Liebesgeschichte, die da miterzählt wird, weil Agraule und Lykophron ganz jung sind und Schmidt hier, gegen Ende der Erzählung, die beiden rührend unerfahren agieren und sie ihre Ungeschicklichkeit eingestehen läßt, während er seine Liebenden sonst ja oft ostentativ kaltschnäuzig auftreten läßt. Hier agieren zwei schnippische Kinder, welche die Gefahr zusammentreibt, die sich Abgebrühtheit vorspielen und denen man Glück wünscht – Liebe in Zeiten von Völkerwanderung und Kulturkampf – und eine glückliche Ehe auf dem Gutshof, der vielleicht eine Insel freien Geistes sein wird inmitten von Atheistenverfolgung und Chaos. Die vergnüglichste Spannung innerhalb dieser Erzählung ist vielleicht die zwischen geradezu antiquarischer Exaktheit im Wissen von Alltagsdetails der Antike und einer um Anachronismen sich nicht scherenden, bis zum augenzwinkernden Spaß gehenden spielerischen sprachlichen Innovationskraft. Was die Darstellung von Träumen angeht – vor allem der zwei großen Träume zu Anfang und in der Mitte der Erzählung – , nimmt sich Schmidt hier große Kühnheiten heraus; so etwas hat sich in der deutschen Literatur um 1955 niemand getraut. Sehr häufig auch benutzt Schmidt Formulierungen, die an den Expressionismus, an August Stramm und Franz Richard Behrens anklingen – hier wird also keineswegs farblos-neutral oder historistisch formuliert – , und schließlich operiert Schmidt vergnügt mit Anachronismen-im-Detail, etwa wenn er den Schlager „Byzantinische Nächte …“ auftauchen läßt, der natürlich als Schnulze in den fünfziger Jahren „Florentinische Nächte“ hieß, oder er läßt schnell im Vorübergehen für den Ausdruck des Nicht-Verstehens das Wort „Kannitverstan“ fallen, was „(ich) kann nicht verstehen“ heißt und der Titel einer berühmten Erzählung von Johann Peter Hebel (1760 – 1826) ist, und schließlich läßt er seinen Lykophron über Agraule liebevoll-spöttisch und auf Englisch (!) ausrufen: „Oh Captain, my Captain!!!–“ und das ist an Doppelbödigkeit kaum zu überbieten, denn es ist ein Zitat aus einem Gedicht von Walt Whitman, also vor der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber in welcher Hinsicht gehört es eigentlich hierher? Soll es heißen, daß siejetzt die Hauptmannsrolle in seinem Leben übernommen und das Steuer in die Hand genommen hat?
Die erzählte Zeit in der „Kosmas“-Novelle beträgt ja nur fünf Tage, und obendrein hat der Erzähler kaum Distanz zum Erzählten; der Rhythmus, die Perspektive, das erzähltechnische Tempo deuten darauf hin, daß dies ein dem Inneren Monolog sehr naher Augenzeugenbericht ist ohne klärende epische Distanz. Aber genau das trägt zur Lebendigkeit bei. In den fünf Tagen vollziehen sich Exposition, Katastrophe und Rettung, oder doch: Flucht (von Marcellus und Eutokios) und Rettung des Besitzes durch Lykophrons Heirat mit Agraule, in einem raschen Text, welcher der Novelle näher als einem Kurzroman.
Worüber wir hier gar nicht geredet haben, ist die „Christliche Topographie“ des Mönches Kosmas der Indienfahrer. Uns erscheint sie ohnehin nur bizarr, eine der Ausweichbewegungen wegen des Verdikts der christlichen Kirche gegenüber dem Weltbild des Ptolemaios; Aber diese Art von konfessionell bedingter oder erzwungener Topographie klingt in unseren Ohren natürlich etwa so böse dumm wie die Vorstellung einer „jüdischen Physik“ im Dritten Reich, wo man glaubte, dergleichen gegen Einstein ins Feld führen zu können; eine „christliche Topographie“ ist für Schmidt natürlich ein schriller Unsinn und Inbegriff der wissenschaftlichen Rückschrittlichkeit der frühmittelalterlichen Christen – schließlich hatten doch die antiken Astronomem schon ein wesentlich genaueres Weltbild gehabt! Da kann man nun wirklich nur sagen, daß reine Wissenschaftlichkeit, reine Empirie, reine Mathematik das beste Kampfmittel gegen jene Ideologien sind, die sich bisweilen auch noch mit dem offensiven, bisweilen sogar aggressiven Missionsgebot des Christentums verbünden. Schmidt jedenfalls entläßt uns mit dem Gefühl, der edleren, genaueren Sache anzugehören, wenn wir für heidnische, die Wissenschaften favorisierende Ungläubigkeit sind.
Jörg Drews: Nachwort zu „Kosmas oder Vom Berge des Nordens“. Ungedruckte deutsche Fassung der französischen Ausgabe „Arno Schmidt: Cosmas ou la Montagne du Nord“, Traduction de l’allemand par Claude Riehl, Postface par Jörg Drews. Éditions Tristram 2006.