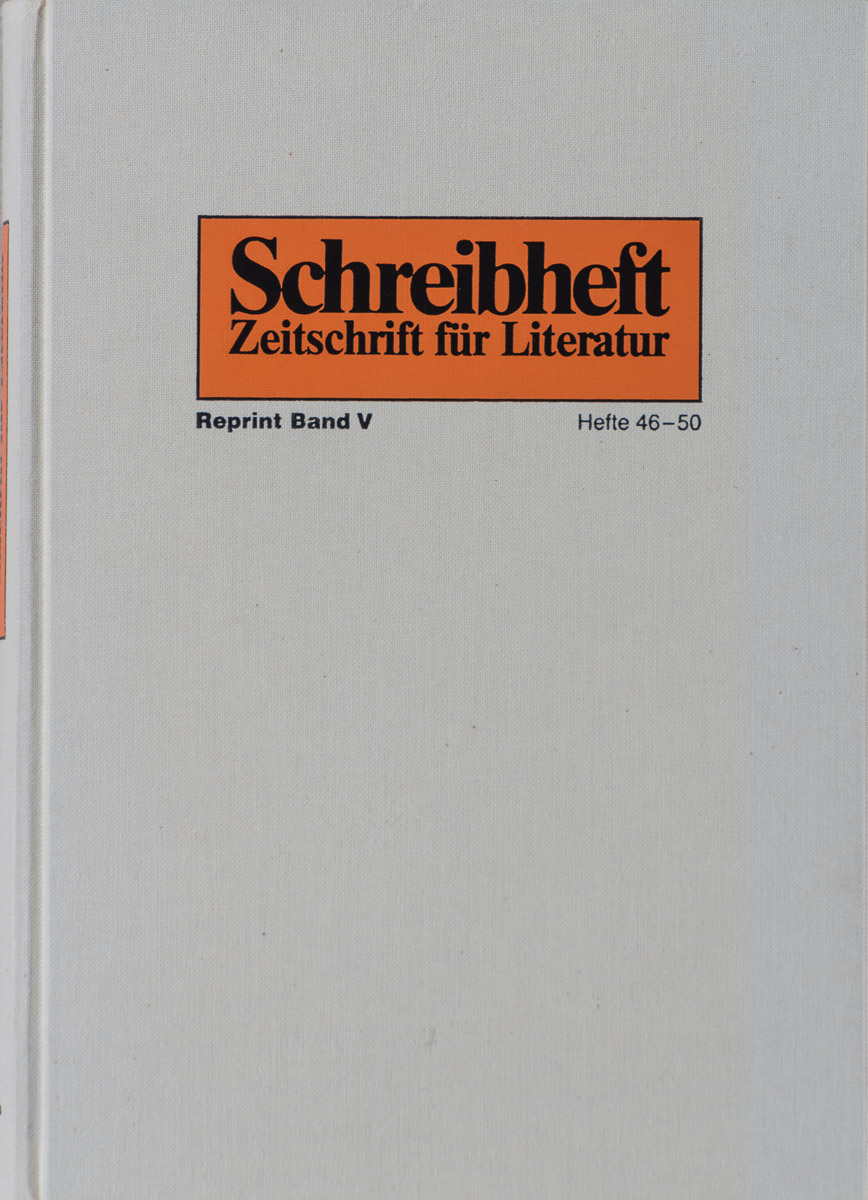Jörg Drews: Laudatio. Das Schreibheft, Norbert Wehr
Im Sommer 1932 konnte man in dem sehr kleinen Lesesaal der Stadtbibliothek von Lauban in Schlesien einen hochaufgeschossenen, etwas schäbig gekleideten jungen Mann mit leicht gewelltem Haar sitzen sehen, der eine ganze Serie von großformatigen Bänden vor sich gestapelt hatte und die offenbar mit großer Aufmerksamkeit durchstudierte. Es handelte sich um viele Jahrgänge der Zeitschrift „Die Aktion“ und „Der Sturm“, und der sie studierte, war der kurz vor dem Abitur stehende Schüler Arno Schmidt. Im Sommer 1933 machte er dann Abitur, pries den Expressionismus und – man hatte inzwischen jene bekannte neue Regierung, die sich den Kampf gegen Kulturbolschewismus auf die Fahnen geschrieben hatte – versaute sich so die Schlußnote in Deutsch: Arno Schmidts Pech. Daß er aber noch, kurz bevor es auch literarisch finster wurde in Deutschland, die expressionistischen Zeitschriften hatte studieren können, bedeutete einen Glücksfall für die deutsche Literatur nach 1945.
Als Arno Schmidt frei seine Sprache wählen konnte, sich also nicht mehr in schwärmerische Pastiches von ETA Hoffmann und Stifter, Fouqué und Storm zu flüchten brauchte und aus der Inneren Emigration sich wieder ins Offene wagen konnte, konnte er auf die Kenntnis einer Sprache zurückgreifen, die seiner Wut und seinem Temperament, seinem Ressentiment und seiner Nervosität, seiner Ungeduld und seinem Wunsch nach umstandslos jähem Ausdruck adäquat war. Arno Schmidts Ausnahmestellung in der insgesamt ja eher geduckten, betulichen und limonadenhaften deutschen Nachkriegsliteratur hängt zusammen mit seiner Kenntnis dessen, was deutsche Autoren sich im ersten Drittel des Jahrhunderts an moderner lyrischer und Erzählsprache erobert hatten und das hatte Schmidt aus Zeitschriften kennengelernt. Unser Glück, wie gesagt, und eine weitreichende Folge der Tätigkeit der großen Zeitschriftenherausgeber Herwarth Walden und Franz Pfempert. Sie seien gepriesen.
Zeitschriften zu lesen, jetzt, heute, wenn sie frisch auf den Tisch kommen, hat viel Ähnlichkeit mit dem Zigarettenrauchen. Sicher mag, wenn die Einzelhefte jahrgangsweise gebunden sind und sich als Dokumentation einer literarischen Epoche, als Schatzhaus jüngster literarischer Vergangenheit präsentieren, die Sache anders sein, doch Zeitschriften zu lesen, wenn man mit jedem Heft auf aktuelle Neuigkeiten, unerhörte Kostproben, unbekannte Namen, unerwartete Perspektiven zu treffen hofft, heißt: sich immer neue 8-Minuten-Zigaretten anzuzünden. Man inhaliert tief und flüchtig zugleich, genießt intensiv, bleibt dennoch unbefriedigt und hat als unvergleichlichen Trost, daß das Eigentliche, der ganze literarische Text, der ganze Autor, ja erst noch kommt, und wenn man sich nicht nach dem Autor als Totalität sehnt, dann darf man doch jippern nach dem Text des nächsten Autors, gleich auf der nächsten Seite, ebenso kurz wie der Text des eben gelesenen Autors: erneut eine Zigarettenlänge, in Erwartung des ultimativen Textes, jedenfalls des noch unbekannten Textes.
Vielleicht meinen Sie, daß dies doch eine zu leichtfertige Metaphorik sei. Na gut, aber erstens ist Sucht wirklich etwas Ernsthaftes, und zweitens kann man’s auch verantwortlicher und seriöser formulieren. Literarische Zeitschriften gehören zu unseren Stimulantien und Lebensmitteln – anders ist ihre Wichtigkeit kaum zu benennen, und über dies sind sie so etwas wie Informationen zum Entwurf oder zur Erweiterung von literarischen Landkarten. Wir können nicht in so vielen Sprachen so viel lesen, wie wir gern möchten, und daher brauchen wir verläßliche Scouts, Kundschafter, die uns Nachrichten und Warenproben verschaffen. Es macht das intensivste Glück wie auch die nicht zu eliminierende Frustration beim Umgang mit Literatur aus, daß die Literatur endlos und ihre Kenntnis immer deprimierend unvollständig ist. Wir wissen, daß wir zu viele Autoren der Vergangenheit nicht kennen – und nicht nur wir, sondern viele Literaturinteressierte; ich denke, daß Zeitschriftenherausgeber wie Kritiker ja durchaus – ob Sie’s glauben oder nicht – sowas wie eine Art Verantwortungsgefühl gegenüber dem Ideal einer umfassend und einigermaßen korrekt vom Wichtigsten unterrichteten Öffentlichkeit haben. Genau deshalb unternahmen wir immer wieder Anstrengungen – und seien diese dann noch so hilflos und im Resultat unbefriedigend –, auf bestimmte Autoren hinzuweisen, ganze literarische Richtungen der Vergangenheit und der Gegenwart vorzustellen, auf Entwicklungen und auf einzelne Autoren hinzuweisen. Unversehens bin ich in ein „wir“ hinübergerutscht, obwohl wir doch zu Ehren eines einzelnen, einer einzelnen Unternehmung, des SCHREIBHEFTS hier versammelt sind. Aber Norbert Wehr wird mir, denke ich, darin zustimmen, daß unsere Tätigkeiten ja ohnehin ineinander übergehen und wir auch dauernd die Funktionen von Lektor, Herausgeber, Kritiker, Literaturwissenschaftler und Übersetzer wechseln, und überdies eint uns auch die – es mag, wie gesagt, sein: chimärische – Vorstellung, es sollte doch so etwas wie ein dichtes, intensives System der Kenntnis von vergangener wie gegenwärtiger Literatur geben, eine Art Kontinuum der Informiertheit über das, was in unserer Welt in der Literatur vorgeht bzw. wichtig zu wissen sei über vergangene Vorgänge in de Literatur, damit wir auch die gegenwärtige Literatur unter solchen Aspekten richtiger einschätzen können. Und das heißt: Eine Literaturzeitschrift – das ist ja das, was uns hier interessiert – muß, wenn sie auf sich hält, als verpflichtende Idee haben, kompromisslos, verantwortlich, mit Gewichtung von Themen und Autoren ein Bild entwerfen von Leistungen und Tendenzen, und dies nicht gleich verwässert oder modifiziert durch kommerzielle Rücksichten oder durch die Angst vor dem Vorwurf, „elitär“ zu sein oder zu wirken.
Wem das nach einer zu abstrakten Ethik der Literaturpolitik klingt, der kann sich bei dem Gedanken beruhigen, daß dies immer nur durch Personen zu verwirklichen ist – und dadurch bekommt die Chose Farbe, Konkretion und jenes Grau von subjektivem „drive“, ohne das es nicht geht. Das fängt beim Herausgeber an, geht weiter über seine Schnüffelnasen, essayistischen Beiträger und Dossier-Zusammensteller und gipfelt in seinen Autoren. Die müssen neugierig sein, sie müssen fleißig sein, und sie müssen sich krummlegen, genau nach dem schönen Wort von Peter Rühmkorf — Wer es zu was bringen will, muß sich ruinieren. Damit was rauskommt, damit auch ein Funke überspringt, muß man was wollen, muß enthusiasmierbar sein und bis zur Spleenigkeit entschieden für bestimmte Autoren, Schreibschulen, Ideen; man muß schwärmen und sich aufregen können. Schwärmen zum Beispiel über das Universum Hermann Melville und sich aufregen darüber, daß der Autor noch immer so wenig bekannt ist bei uns, da kommt ein so perfekt komponiertes Heft heraus wie Nr. 37 vom Mai 1991 (sowas kriegt man natürlich auch nicht alle Tage zusammen), dann juckt es einen, Louis-Ferdinand Céline erneut vorzustellen und zu beleuchten und einmal mehr den Skandal anzuprangern, daß dieses Autors wichtigstes Buch nur in einer hochgradig entstellten, den Übersetzer Isak Grünberg quasi expropriierenden Übersetzung seit 60 Jahren auf dem Markt ist und der Rowohlt-Verlag offenbar nichts zu tun gedenkt, um „Reise ans Ende der Nacht“ adäquater zu präsentieren und überhaupt dem Werk Célines eine andere Präsenz zu verschaffen; dann juckt es einen auch, Vladimir Nabokov durch Hermann Wallmann präsentieren zu lassen (wie vor zehn Jahren geschehen) mit einer Begeisterung, die man geradezu angedreht nennen könnte und die sogar noch die Fußnoten durchglüht, und dann springt man natürlich auch drauf, schon 1987 Deutschland Vladimir Sorokin zu präsentieren, uns eine Bekanntschaft also mit einem Autor zu ermöglichen, die einem stinkenden Faustschlag gleicht, für den man obendrein noch dankbar ist.
Vielleicht kennzeichnet das das Verhältnis, das man zu seiner Lieblingsliteraturzeitschrift haben muß: daß man zur einen Hälfte sich durch das, was sie bietet bestätigt fühlt – unter dem Motto: Wenn die auch auf den oder den von mir geschätzten Autor gestoßen sind, ihn drucken und propagieren, dann lieg ich ja wohl nicht schief mit meinem Urteil, und zum anderen durch die Vorstellung von neuen Autoren ergötzt wird, deren Bekanntschaft zu machen einem sinnvoll erscheint, die man gleich in sein literarisches Sonnensystem einbauen und auf die das eigene Sensorium, das eigene Sonnengeflecht gleich reagiert. Oder, wie’s der berühmte Literaturkritiker, der weise alte Mönch von sich selbst als kleinem, jungem Mönchlein berichtet, dem ganz zaghaft die große und doch fast betulich formulierte Einsicht aufging – Adson von Melk hieß er übrigens, wie wir alle wissen können: „Nun ging mir plötzlich auf, daß die Bücher nicht selten von anderen Büchern sprechen, ja, daß es mitunter so ist, als sprächen sie miteinander.“ Tun sie auch. Nicht immer freundlich natürlich, oft auch einander widersprechen, überbieten, vernichten wollend, auch schreiend oder höhnisch, aber: noch in ihrer Kollision sind sie beredt.
Im Herbst 1982, mit dem Heft Nr. 20, stieg ich in die SCHREIBHEFTlektüre ein. Wenn ich die 24 Hefte überblicke, die seither erschienen sind, also einen Schritt zurücktrete und mir überlege, was diese Hefte gemeinsam haben und wie sie sich entwickelten, dann muß ich Norbert Wehr ins Gesicht hinein sagen, daß sein Unternehmen und dessen Maßstäbe an Souveränität und Karat gewonnen haben. Einiges an beflissenen kleinen Rezensionen, überhaupt an Aufmerksamkeit fürs Literaturbetrieblich-Unmittelbare ist nach und nach weggefallen. Ich habe das Gefühl, daß der Herausgeber sich für nichts mehr entschuldigt und sich nur noch vor ziemlich hoch angesiedelten Instanzen verantwortet. Gewiß ist es unsinnig, literarische und politisch-intellektuelle Zeitschriften gegeneinander auszuspielen, aber wenn ich mal nur die Vorstellung von Literatur herauszupräpariere, die die letzten 20 SCHREIBHEFTE zu prägen scheinen, so denke ich: Die Massivität, die ruhige Festigkeit, die Überzeugungskraft, das diese Hefte ausstrahlen, kommt daher, daß hier nicht leichtfertig und populistisch Maßstäbe preisgegeben wurden. Es ist ja ganz einfach, vif und erleichtert etwa den „Avantgarde“-Begriff preiszugeben und gewissermaßen – ein zweites Mal, analog zu Hegels Diagnose – die Kunstperiode, sprich hier: die literarische Moderne und ihre Intentionen, ihre Anstrengungen und ihre Wertmaßstäbe preiszugeben: Das macht das Leben leichter und erlaubt fröhliches Zeitgeist-Surfing. Nun ist die Frage, ob irgendjemand den Avantgarde-Begriff wirklich so geradezu verdinglicht ernstgenommen und vor allem an dessen Koppelung an eine Art Geschichtsphilosophie und Geschichtsphilosophie der Kunst wirklich noch festgehalten hat; auf jeden Fall aber müßte dann mitdiskutiert werden, wie dann Kriterien für Qualität, für den Rang von literarischen Werken, dafür, daß sie in einem emphatischen Sinn auf der Höhe der Probleme unserer Zeit sind, auszusehen hätten. Die pauschale Verurteilung der Moderne oder vielleicht eher: das Sich-ihrer-Entledigen gehört ja im Moment zum guten Ton; es gibt den ernsthaften Vorschlag in der FAZ, doch erzählerisch am besten sich wieder hinter bzw. vor die Moderne zurück zu begeben und diese Verirrung moderner Erzählverfahren z.B. zu liquidieren zugunsten einer Rückkehr zu Theodor Fontanes „Stechlin“; es gibt pauschale Verabschiedungen aller „experimentellen“ Poesie (das Wort selbst ist fast ein Schimpfwort), und in dieser allgemeinen Atmosphäre entschlossener Reduktion von Komplexität bzw. des Bekenntnisses dazu läßt auch Ulrich Greiner in der ZEIT die Sau raus, indem er endlich eingesteht, Oswald Wieners „verbesserung von mitteleuropa“ noch nie verstanden, aber natürlich einstmals ängstlich konform gepriesen zu haben; jetzt aber dürfe er’s endlich ungestraft sagen: es sei pseudokomplexer Murks, unverständlicher, und überhaupt: wir brauchten „viel weniger Kultur als wir dachten“. Das meint auch Uwe Wittstock, der Lektor eines angesehenen deutschen Verlages, der in der SZ und der NEUEN RUNDSCHAU einfachere, lesbarere, sprich (wie er ganz offen sagt): verkäuflichere Bücher von den heutigen jüngeren Autoren fordert. Solch neueste populistische Stimmung im Westen macht das SCHREIBHEFT nicht mit. Das kommt davon, daß hier einer die Literatur nicht glatt der Unterhaltungsbranche und dem mittleren realistisch-psychologischen Roman als Maßstab aller Dinge überantwortet, sondern weiter überzeugt ist vom spezifischen Eigen- und Erkenntniswert des ästhetischen. Eine Auflage von 2500 verkauften Exemplaren bei einer so kompromißlosen Literaturpolitik, (bei Literatur pur als Programm) ist gar nicht so schlecht, gar nicht so niederschmetternd, wenn man bedenkt, daß Zeitschriften mit höherer Auflage immer auch noch allgemeinen intellektuelle, theoretische, politische, kulturelle Interessen bedienen, vom FREIBEUTER bis zum MERKUR, von der NEUEN RUNDSCHAU bis zum LITERATURMAGAZIN. Ich bin mir im übrigen noch nicht mal so sicher, ob wir eine besonders schlechte Zeit für Zeitschriften wirklich haben. Die Position der Literatur als einer via regia zur Einsicht in die Welt ist ja in der Tat nicht mehr unangefochten, und unabhängig davon, wie man Wert und Notwendigkeit von Literatur einschätzt, ist auf jeden Fall die Konkurrenz durch schrill-gefällige andere Medien größer geworden. Es ehrt Norbert Wehr, daß er in dieser Situation sich nicht bestechlich zeigt. Mag die Epoche des emphatischen Projekts literarischer Moderne vorbei sein: sie hat auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt in der Durchreflektiertheit und Durchbildung literarischer Texte und darin, daß eine Voraussetzung bedeutender künstlerischer Arbeit ist, sich dem allgemeinen Konformitätsdruck radikal nicht zu beugen, und es auch dem Publikum aus Achtung vor dem Publikum nicht billiger zu geben. Ich weiß, ich hab leicht reden, und Wehr muß es ausbaden, muß sein Geld mit Brotarbeiten verdienen, und wir feiern ihn dann in manchen Stunden als Einzelkämpfer. Ich kann’s aber nur mit schnöder Unbarmherzigkeit sagen: o.k., ab und zu gibt es einen Preis oder einen Zuschuß, damit das SCHREIBHEFT weitergehen kann, grundsätzlich aber bleibt das Unternehmen ungesichert, das ist wahr. Tu l’a voulu, Georges Dandin!
Ich habe ein grundsätzlich unsentimentales Verhältnis zum SCHREIBHEFT; ich brauche eine solche Zeitschrift, und wenn und solange es sie gibt, nehm ich sie mir und bin Norbert Wehr natürlich nebenbei auch ein bißchen dankbar, daß er durchhält. Er macht halt eine Zeitschrift für Leute, die an der Krankheit leiden, Sprache körperlich zu erleben, Sprache, öffentliche Sprache sogar auch vor allen Inhalten schmerzhaft wegen ihrer Entstellung und lustvoll bei ihrem Glücken wahrzunehmen, sie zu spüren, sie zu genießen. Qual und Glück solcher Spracherfahrung honorieren eben vielleicht wirklich nicht mehr als ein paar Tausend Leute in Deutschland, und es mag ja auch sein, daß nur ein paar Tausend Leute für sich die Maxime aufgestellt haben, sich nicht billiger abspeisen zu lassen, da sie nun einmal erfahren haben, wie verantwortlich, mit welcher Qualität, mit welcher Lust sie verwöhnt werden bei den großen Prosaautoren wie James Joyce. Warum solle ich mir vom Markt die Maßstäbe vorschreiben lassen und mich verteidigen wegen meines Festhaltens an Maßstäben, welche die Literatur schließlich einmal gesetzt hat?
Die Literatur, das heißt am Ende auch: Goethe selbst, den zu zitieren keine anständige Germanistenrede unterläßt. Besagter Goethe hat von Weltliteratur gesprochen – und nicht davon, daß tendenziell nur gehobene Unterhaltungsliteratur und nur aus dem Englischen übersetzt werden solle. Es gibt noch einige Sprachen mehr, vom Spanischen über das Italienische und das Niederländische zum Russischen: Das weiß das SCHREIBHEFT UND ZEIGT ES IN FAST JEDEM Heft, und insofern ist sogar dies Organ – das hätte es selbst nicht gedacht! – Goethetreu an der richtigen Stelle.
Lieber Norbert Wehr, daß Du weitermachst, ist notwendig. Wie Du das machst, ist Deine Sache. Wie schwierig das auch Tag für Tag sein mag – nur wenn das SCHREIBHEFT das Notwendige, das Rücksichtslose, das künstlerisch verantwortungsvoll Vorangetriebene das Radikale versammelt, besteht die Chance, daß in 20 Jahren ein junger Autor die Hefte studiert und daraus lernt – nicht, was einmal verbindlich-unverbindlich-leserfreundlich angesagt war, sondern: was Literatur kann, was Literatur sein kann.
Jörg Drews, Laudatio. Das Schreibheft, Norbert Wehr. Calwer Hermann Hesse-Preis 1994, https://www.hermann-hesse.de/files/schreibheft.pdf
Abgerufen am 7.10.2018.
Auch in: Jörg Drews (Hrsg.):Vergangene Gegenwart – Gegenwärtige Vergangenheit. Studien, Polemiken und Laudationes zur deutschsprachigen Literatur 1960–1994. AISTHESIS VERLAG Bielefeld 1994, S. 244–249.