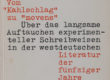Jörg Drews: Those were the days, my friend
oder: „Zur Erinnerung an Ihren [= meinen] Werkstattbesuch“
Stunden bei und mit Arno Schmidt
You won’t see nothing like the mighty Quinn
— Manfred Mann
Wir alle kennen die Warnungen. Schmidt selbst hat es mehrfach barsch und weise zugleich ausgesprochen, es müsse unweigerlich zu Enttäuschungen fuhren, wenn man einen Autor persönlich kennenlerne. Die ideale Vorstellung, die man sich von ihm mache, speise sich ja vor allem aus dem Werk des Verehrten, der Autor als realer Mensch aber müsse schon deshalb enttäuschend und ‚uneigentlich‘ wirken, weil er sich als verantwortungsvoller Schriftsteller ganz in sein Werk hinein verausgabe und vor Besuchern nur – das Beispiel Wieland! – schlaff und abgearbeitet herumsitzen könne, als „schäbiger Rest“ gewissermaßen – von dem Problem, daß auch die Moral eines Autors grundsätzlich eher im Werk als in seinem menschlich-alltäglichen Handeln und Gebaren stecke, mal ganz abgesehen. Ich war also gewarnt, nicht die ‚Vollkommenheit‘ der Schriften mit der Vollkommenheit der empirischen Person des Autors gleichzusetzen, noch weit bevor mir an Johann Gottfried Seume aufging, daß Moralismus eine schriftstellerische Haltung ist, die gerade aus der Scham darüber stammen kann, besonders häufig moralisch zweideutig gehandelt zu haben.
Der Zug war pünktlich an diesem 24. Oktober 1964, der rote Triebwagen auf der Strecke Celle – Hankensbüttel – Wittingen; er lief um 14.21 Uhr im geschäftigen Eldingen ein, und dann pilgerte ich die Landstraße von Eldingen nach Bargfeld entlang, hin zum Mythos und hinein in den Mythos, und zugleich darauf aus, Mythos und Legende durch den Augenschein zu ersetzen, das Wundertier aus Königsgeschlecht kennenzulernen. Trotz aller Warnungen hatte ich im Grunde gar keine Wahl; die Faszination, die Arno Schmidts Werk und Existenz ausübte, war zu groß, als daß man eine Gelegenheit hätte ausschlagen können, den großen Einsiedler kennenzulernen – daß ich überhaupt eingeladen war, ihn zu besuchen, stellte ja schon einen Sonderfall dar. Zehn Jahre lang war ich damals schon Schmidt-Leser, seitdem Klaus Kennel und ich aus den Kästen einer bankrottierenden Buchhandlung in Kaiserslautern bei deren Räumungsverkauf „Aus dem Leben eines Fauns“ und „Brand’s Haide“ uns geschnappt hatten. Und jetzt, vor ein paar Monaten, im Juli 1964, war der Erzählungsband „Kühe in Halbtrauer“ erschienen, in dem lesend wenige Tage zuvor zwei Studenten einander erblickt hatten, ‚soul brothers‘, vor dem Kaminfeuer sitzend im Wasserschloß Schwöbber bei Hameln: Klaus Podak und ich. Was dazu führte, daß wir in der folgenden Nacht vor lauter besoffener Begeisterung beinahe in den Wassergraben des Schlosses gefallen wären: Es gab so viel zu bereden und zu trinken, von Schmidt befeuert.
Wir waren des Autors voll, der einer kleinen Truppe von Lesern zu suggerieren verstanden hatte, daß bei ihm und durch ihn ganz speziell Wichtiges verhandelt werde, abseits der breiten Heerstraße des allgemeinen Philologenvolks und Leservolks und mit Rückbezug auf feinste, aber vernachlässigte, ja verachtete Teile deutscher literarischer Vergangenheit und zugleich in dezidiert moderner politischer und literarischer Beleuchtung. Man durfte sich als Schmidt-Leser in linken politischen Traditionen, in antiklerikaler, antimilitaristischer, kurz: aufgeklärter Nachbarschaft fühlen, und zugleich wurden beim Kritiker nur Autoren höchsten Ranges als Herausforderung und Maßstab anerkannt; als Joyceaner konnte man nur beifällig nicken, wenn der zentrale literarische Name fürs 20. Jahrhundert bei Schmidt James Joyce lautete und der entscheidende Theoretiker für ihn Sigmund Freud war.
Wie kam ich dazu, nach Bargfeld eingeladen zu werden? 1963 hatte ich in der studentischen Monatszeitschrift „Civis“, einer CDU-gesponserten Postille – deren Feuilleton aber der unabhängige Otmar Engel, der damals schlaueste deutsche Filmkritiker, regierte: Was kümmerte uns die CDU, im vorderen Teil, wenn hinten das Feuilleton toben durfte und wir über Max Bense und Louis Armstrong, Peter Weiss, Ingrid Stroh-Schneider-Kohrs und Arno Schmidt schreiben konnten? – eine Titelstory „Arno Schmidt: Außenseiter oder Mittelpunkt?“ veröffentlicht (die alberne Pseudoalternative des Titels war nicht auf meinem Mist gewachsen!), die vor allem Frau Alice gefallen haben mußte und Schmidt offenbar positiv referiert worden war. Obendrein hatte ich bisweilen Schmidt ein Buch geschickt, darunter Hellmut Draws-Tychsens (des Scheerbart-Herausgebers) Buch über Schulze-Celle – vgl. den Brief Schmidts auf S. 8 des vorliegenden Heftes –, von dem ich auf Grund von Schmidts Büchern und Zeitungsartikeln annahm, daß es ihn interessieren und er in seiner ostheidnischen Abgeschiedenheit nur schwer würde drankommen können. Das war mit zwei Postkarten und einem Brief von Arno Schmidt honoriert worden, und da sich in einem Brief Schmidts die überraschende Formulierung fand, falls ich mal in seiner Gegend vorbeikäme, solle ich ihn doch einmal besuchen, mich allerdings vorher anmelden, wäre es mir geradezu hirnverbrannt vorgekommen, auf diese Offerte nicht einzugehen: ’ne Audienz beim Genius schlägt man doch nicht aus!
Ich spazierte an diesem Herbstnachmittag durch eine Landschaft, von der mir vom Baumbestand über den Knick der Straßenführung und das Ortsschild samt kleinem Dorfbach, Eichkamp und Bangemanns stattlichem Dorfgasthaus alles schon aus der Literatur bekannt war: mir fielen sofort – von „geschäftig“ über „stygisch“ bis „waldreich“ – die Adjektive ein, die Schmidt dem Dorf Eldingen, einem Bach oder einem anderen Nachbardorf gegeben hatte, und so sehr ich wußte, daß die Wirklichkeit nicht die Literatur erklärt – auf einer bestimmten Ebene war Schmidt ein Topograph ersten Ranges, einer, der die Wirklichkeit in ausgewählten Details geradezu ‚ab‘-schreibt. Daher das Gefühl, auf dem Weg nach Bargfeld im Oktober 1964 zum ersten Mal erlebt, in der Literatur herumzulaufen, einen Landschafts- und Dorfprospekt zu betrachten, in dem man mit Leichtigkeit die von Schmidt erfundenen Personen und Handlungen hineinprojizieren konnte, wodurch das Verwechselspiel noch bezaubernder, auch lachhafter und ein bißchen unheimlich wurde, nicht zuletzt deshalb, weil ich mich vom Eldinger Bahnhof bis zu Schmidts Grundstück sofort exakt auskannte und keine Sekunde zögerte, meinen Weg zu finden: Schmidt der Topograph, wie gesagt. Obendrein kam mir dieses Norddeutschland, von dem ich fast nichts kannte, reichlich – na, eben norddeutsch vor.
Exakt 15 Uhr – Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der kleinen Leute – stand ich vor seinem großen verketteten Gartentor und er ein paar Sekunden später dahinter. Betont lässig war er nähergeschlendert, mit der Attitüde dessen, der ganz ‚Herr seiner Latifundien‘ ist; 1.86 groß (wie ich wußte), ziemlich massiv, sich langsam bewegend, bisweilen den Kopf wendend und außer mir noch allerlei anderes musternd, als wollte er mir Gelegenheit geben, von ihm, der Umgebung und diesem bedeutenden Moment in meinem Leben in Ruhe entsprechend beeindruckt zu sein. Sein Auftritt hatte etwas komisch Inszeniertes, sein Benehmen etwas ironisch Geschauspielertes, und zugleich doch eine unmittelbare Würde; ich kann es nicht anders sagen. Das Bewußtsein, daß Schmidt nur sehr wenige Leute bei sich vorließ, gab mir sicher im Moment des ersten Besuches und der folgenden Besuche bis 1970 sowie der Begegnung 1975 ein besonderes Gefühl der Intensität des Erlebens, des Gespanntseins; heute weiß ich natürlich, daß die Zahl der Besucher des Eremiten gar nicht so gering war, wie es die Legende wollte; von Ernst Krawehl und Eberhard Schlotter, von Hans Wollschläger, Helmut Heißenbüttel und Max Bense bis zu Klaus Reichert, Eike Barmeyer und – wenige Monate vor Arno Schmidts Tod, im April 1979 – Rudolf Augstein und einer Bielefelder Soziologin, waren immer wieder Gesprächspartner vorgelassen worden, aber es gehörte eben zu der Inszenierung seiner Existenz – einer Inszenierung, die nicht Willkür war, sondern ihrerseits psychischen Notwendigkeiten folgte –, Besuchern den Eindruck zu vermitteln, es werde ihnen eine besondere Ehre zuteil. Heute weiß ich auch, daß Arno Schmidt über manche Besucher, mit denen er sich munter stundenlang zu unterhalten schien, haltlos abfällige Bemerkungen samt Bekundungen des Bedauerns über die Zeitverschwendung mit ihnen in sein Tagebuch eintrug. Was immer er über mich (und Jürke Grau, meinen Freund, sowie bisweilen die beiden Freundinnen) nach Besuchen notiert haben mag: Er hatte angekündigt, gleich zu Beginn meines ersten Besuchs, als wir an diesem strahlenden Oktobertag noch im Garten herumstanden und dann auf seiner kleinen Veranda saßen, er habe nur zwei Stunden Zeit, denn er arbeite bekanntlich intensiv an der Poe-Übersetzung. Aber erst um 19.40 Uhr, nach mehr als vier Stunden, wurde ich entlassen, und unsere Münder waren keinen Moment stillgestanden; es gab außerdem Tee und Kuchen und Cognac und Cigaretten – für mich; notfalls wurden die Roth-Händle, wenn sie mir (damals) Qualmer ausgingen, sogar von Arno Schmidt telefonisch bei Frau Bokelmann geordert und von dieser an den Zaun gebracht. Schmidt schaute mir nur amüsiert zu beim Verzehr, zog seine bekanntlich enorm mobile linke Augenbraue hoch über diese und jene Bemerkung und lachte meist seltsam gespreizt und zugleich dröhnend vor allem über seine eigenen Witze und literarischen Anekdoten.
Für diesen und die folgenden Besuche bei ihm bis 1970 gilt, daß ich mich zu meiner eigenen Überraschung sehr wohl fühlte und nur am Anfang angespannt war; dann fühlte ich mich meist geradezu zunehmend erheitert besonders durch Schmidts Art, die bei aller ins Feld geführten Autorität so wirkte, als wolle er einem wirklich was beibringen, wolle dem jungen Adepten durchaus auch was bieten, Tips und Bücher, Hinweise zu Details seines Werkes, mit Stolz erteilte Erlaubnisse, auf Manuskripte oder in Zettelkästen Blicke zu werfen, von denen er mit bisweilen fast bubenhaftem Stolz wußte, als welche Rarität man solche Lizenzen verbuchen würde. Von der letzten Begegnung im Sommer 1975 abgesehen, die unter einem sehr kuriosen Stern stand und Schmidts Unfähigkeit zeigte, simple Konflikte zu formulieren und auszutragen (vgl. auch im vorliegenden Heft Reinhard Finkes Erinnerung an eine „nicht-zufällige Begegnung“ im Sommer 1975 unter dem Titel „Schmidt und einer seiner Bewunderer“), habe ich die Gespräche mit ihm als aufgeräumt und lebendig in Erinnerung und als um so entspannter, je weniger Leute dabei waren beim Kaffeetrinken, beim Essen bei dem – in den sechziger Jahren noch – befreundeten Studienratsehepaar Michels, das Haus, Grundstück und einen eigenen entzückend verwunschenen Teich in Bargfeld hatte, und bei Autofahrten und Spaziergängen durch die Heide samt Lokalterminen an poetischen Örtern. Vielleicht verlor ich, bei allem Respekt, aus lauter naivem, bubenhaftem Vergnügen an seiner Gesellschaft einen Großteil meiner Befangenheit; rückblickend finde ich es eher erstaunlich, daß die Besuche so glatt verliefen. Denn Arno Schmidt war ja Widerspruch wenig gewohnt, ich meinerseits blieb aber auf seine giftigen Bemerkungen etwa über Helmut Heißenbüttel oder Samuel Beckett völlig stur bei meiner Meinung und sagte ihm auch, daß ich gerade diese beiden für große Autoren hielte; seine Bemerkung, bei Heißenbüttel stehe doch auf den großen Seiten der „Textbücher“ „fast nix druff, iss doch sehr viel weiß“ fände ich doch reichlich kurios: auf die Quantität komme es doch nicht allein an, und habe er selbst nicht einst für „dehydrierte Prosa“ plädiert? Die Bemerkungen über Alfred Andersch – der Mann habe doch „keine inneren Ressourcen“, wenn er um das schwache Buch „Efraim“ zu schreiben, extra nach Berlin fahren müsse, um sich Anschauung zu verschaffen – hörte ich mir schweigend an (Andersch schätzte ich auch nicht so sonderlich, gerade auch „Efraim“) und ebenso schweigend, aber innerlich glattweg entsetzt quittierte ich seine verständnislosen Bemerkungen über die Collagen von Max Ernst, welche gerade eben erst endlich in einem deutschen Verlag, nämlich bei Renate Gerhardt in Berlin zu erscheinen begannen. Renate Gerhardt übrigens hatte bei ihm angefragt, ob sie eine Passage aus „Caliban über Setebos“ in eine Anthologie lesbischer Prosa mit dem Titel „Frau und Fräulein“ übernehmen dürfe, worauf Schmidt sagte, solche „Literaturhuren“ schätze er gar nicht. Wenn ich in solchen Fällen widersprach oder konsterniert oder stur schwieg, schaute Schmidt mich nur kurz an, knurrte erstaunt und ging drüber weg. Oder schien doch darüber wegzugehen, und in Wirklichkeit begann ich vielleicht in diesen Momenten schon, mein „Konto zu überziehen“, wie er das später formulierte.
Weil die Besuche, die Spaziergänge und Gespräche meist also nicht den Charakter von Audienzen hatten, sondern oft mehrere Stunden dauerten, habe ich mir danach nur ganz wenige Aufzeichnungen gemacht, und nur im Sommer 1967 sprach ich abends nach drei längeren Besuchen bei ihm und Spaziergängen mit ihm Notizen auf ein Tonband, die erhalten sind. Natürlich fiel mir damals gleich und ziemlich unbehaglich ein, daß ich nun in einer Eckermann-Situation sei und alles aufschreiben müsse – und eben deshalb tat ich es nicht oder nur ganz spärlich; ich habe nach den Gesprächen mit Schmidt nur sechs Zettel mit Stichworten gefüllt und nahm im übrigen die Stunden mit Schmidt eher wie gelebtes Leben, das ich nicht gleich auf alberne Weise musealisieren wollte. So brennend mich alles interessierte, was Schmidt sagte und tat, so wenig wollte ich gleich danach die heiligen Worte des Meisters notieren und aus jeder Bemerkung einen Fetisch machen. Damals zeichnete sich ja durchaus schon der Typus des ›Schmidt-Fans‹ ab, des Detail-Fetischisten, der die Zettelkästen, aus denen Schmidt seine Bücher zusammenmontierte, wieder in seine eigenen Verzettelungen zurückarbeitet, notfalls sogar in der Mülltonne (dies ist keine Metapher!) nach Schmidts Papierschnitzeln wühlt und eigentlich nicht weiß, was er da tut. So selbstkritiklos, so blind identifiziert war mein Verhältnis zu Schmidt nun doch nicht. Heute bereue ich es allerdings doch sehr, nicht mehr Aufzeichnungen gemacht zu haben als die paar Notizen auf fliegenden Blättern. Auch das eigene Gedächtnis, auf das man sich als 26-32jähriger Dachs glaubt verlassen zu können, ist natürlich in Wirklichkeit trügerisch.
Worüber sprachen wir auf Autofahrten zu den Fischteichen von Räderloh, auf Spaziergängen nach Marwede, in Schmidts Garten, im Wohnzimmer des holzverschalten Häuschens auf der zersessenen roten Couch, unter Eberhard Schlotters Gemälde „Bugwelt“ (des Häuschens, das Alfred Andersch immer herablassend und kopfschüttelnd „Schmidts Klitsche“ nannte), in Schmidts Arbeitszimmer und Bibliothek im ersten Stock, in Nachbarschaft der großen Reproduktion von Johann Hieronymus Schröters 28-füßigem Teleskop, die unterm Ostfenster des Raumes hing und nur zu sehen war, wenn die Klapptür über der Treppe nach unten geschlossen war? Über Literatur natürlich vor allem. Ich hatte immer eine kleine Liste von Fragen bzw. Funden zu seinen Texten, auf die ich mir Antwort oder Bestätigung erhoffte, und Schmidt spielte das Spiel sehr geschickt: Er verriet etwa, woher ein Zitat kam und wohin eine Anspielung führe, belobigte mich für’s Ausfindigmachen von Zitaten, die er nicht nach ihrer Herkunft gekennzeichnet hatte, verweigerte dann aber wieder Auskünfte, deutete Zusammenhänge an, die man doch gefälligst selbst herausfinden sollte, suggerierte, es liege noch manches in seinen Schubladen – er müsse schließlich für seine Frau sorgen, damit die was zu veröffentlichen habe, wenn er tot sei. Mit großem Stolz verwies er immer wieder darauf, gerade nächsten Mittwoch sende der Südwestfunk diesen Radio-Essay von ihm, und Heißenbüttel in Stuttgart wiederhole demnächst jenen Funk-Dialog – im Sommer 1966 brachte er in fünf Sätzen die Titel von vier seiner eben gesendeten oder in den nächsten Tagen zu sendenden Radio-Essays unter: „Finnegans Wake“, Jules Verne, Collins und Lafontaine erschollen dicht an dicht –, und überhaupt: ein gutes Dutzend Funk-Features sei noch da und warte drauf, gesendet zu werden, was er so schwebend formulierte, daß man den Eindruck haben konnte (ich ihn jedenfalls hatte), diese und andere Features lägen allesamt sendefertig auf Halde. Er weidete sich wohl an meiner Verblüffung und meiner Vorfreude darauf, noch so viele Texte von ihm erwarten zu können, und zugleich hatte ich sowohl bei ihm wie bei seiner Frau den Eindruck, daß sie schier barsten vor Stolz darüber, daß Schmidt ein Autor war, von dem ganz locker diverse Rundfunkstationen dauernd Altes und Neues brachten, der also literarisch gewissermaßen auf großem Fuß lebte …
In der Erinnerung erscheinen mir die meisten der Besuche bei Arno Schmidt und seiner Frau heiter und wie verklärt. Das kommt wohl erstens daher, daß ich Schmidts fast nur im Sommer und einmal an einem – wie gesagt – sonnig-warmen Oktobertag besuchte; Schmidts Haus und Garten und die Landschaft waren dann in Grün oder in rotgoldene Herbstfarben eingebettet und sonnenbeschienen, und mag Andersch auch das Haus in Bargfeld eine Klitsche genannt haben – es hat halt nicht jeder ein Domizil im Valle Onsernone, und mir kam’s in Bargfeld ärmlich und paradiesisch zugleich vor: Was brauchte man denn mehr zu heiter-ungestörter Arbeit? Zweitens war ein Gespräch mit Arno Schmidt etwas wie ein Gespräch mit einem Vater, einem ungewöhnlichen Professor oder gelehrten Studienrat alten Stils und einem Künstler zugleich. Ich will mich hier nicht auf eine Spekulation darüber einlassen, welche tiefenpsychologischen Hinter- bzw. Untergründe die Schmidt-Verehrung des harten Kerns der Leser-Gemeinde hatte, die alles, aber auch alles von ihm und über ihn sammelte und im übrigen in ihrer Majorität eingestandene oder heimliche Besuche im Dorf Bargfeld absolvierte – halb wallfahrend, halb einfach unbezähmbar neugierig –, doch mir scheint sicher, daß Schmidt auch die Rolle eines Ersatzvaters im seelischen Haushalt der fanatischen seiner Leser erfüllte; außerdem konnte man in der Gestalt und der Rolle Schmidts den Gelehrten und Künstler erblicken, der in widrigsten Umständen und ohne Hilfe durch Institutionen wie Universität, Verlage usw. als Einzelkämpfer sich eine Position erarbeitet hatte und diese hielt, und zwar eben nicht in einer Institution und also mit deren Gehalt und Rückendeckung. Vielmehr lebte er einzelkämpferisch und quasi-autodidaktisch; als Außenseiter führte er eine intellektuell-künstlerische Existenz, für deren Unabhängigkeit er den Preis dauernder ökonomischer Gefährdung zahlte. Was uns imponierte, war die Mischung aus Monomanie, Idyllik und Kargheit, welche sein Leben und seine Arbeit in Bargfeld kennzeichnete. Seine Existenzform enthielt das Versprechen, daß es eben doch möglich sei, wenn man bescheiden und fleißig war, ausschließlich der Literatur zu leben. Was Schmidt geschrieben hatte und sagte, waren Mitteilungen aus eben dieser von ihm so hochgehaltenen Sphäre einer unabhängigen intellektuell-künstlerischen Existenz: Kaum jemals später versprach ich mir von Mitteilungen aus dieser ‚Werkstatt‘ des Artisten so viel wie in jenen Jahren aus der ‚Werkstatt‘ von Arno Schmidt, und mit diesem Gefühl und dieser Erwartung war ich nicht allein, wofür auch jene – stellenweise bis heute etwas laienhafte – Schmidt-Philologie zeugt, die bereits zu seinen Lebzeiten erblühte. (Und wir können sagen, wir seien dabeigewesen…)
Heute kennen wir ziemlich genau die Bestände seiner Bibliothek, jedenfalls nach dem Stand zum Zeitpunkt seines Todes. Damals bedauerte ich es, daß ich nicht noch länger allein gelassen wurde mit seinen Büchern, mit seiner legendären Bibliothek, die ja skurril exquisit sein mußte, wenn er aus ihr so viele geheimnisvoll funkelnde Zitate zog. Aber er fürchtete – wohl mit einigem Recht –, daß unbeaufsichtigte Besucher vielleicht der Versuchung nicht würden widerstehen können, und außerdem teilte er viele Lektürefrüchte, Hinweise auf lesenswerte Bücher und auf Quellen zu seinen eigenen Büchern außerordentlich freigiebig mit, nachdrücklich wie ein Vater und Lehrer, ein bißchen wie ein dem jungen Mann vor ihm auf die Schulter klopfender Guru und doch sehr ernsthaft, freundlich und bisweilen einem Titel zur Lektüre sehr eifrig ans Herz legend. Man muß sich auch vorstellen, daß gerade in jenen späten sechziger Jahren das Gerücht umging, Schmidt sitze neben der Poe-Übersetzung an einem Riesenbuch (von dem dann auch der Titel „Zettels Traum“ durchsickerte), was er dann bestätigte – aber damit wußte man ja auch noch nicht viel mehr, und in diese von ihm unterstützte Unsicherheit hinein – zunächst ließ er mich in dem Glauben, das Buch heiße „Die unsichtbare Magd“ – fiel dann die Beobachtung, daß auf seinem Schreibtisch nicht nur Zettelkästen, Lupen und ein großes Nordmende-Radio – „hat 500 Mark gekostet!“ – standen, sondern auch, im Halbkreis um den halbkreisförmigen Einschnitt in seine riesige Schreibplatte angeordnet, die Menge der Lexica, dazu die Werke Edgar Allan Poes und z.B. ein „Dictionary of Sexual Perversions“, und: von diesem Schreibtischplatz aus konnte man durch die nördliche Dachluke ziemlich gut durch die damals noch schüttere Baumreihe hindurch zum Badeteich sehen, wo sich die dörflichen Nixen in wesentlich unschuldigeren Stellungen vor Schmidts Fernrohr tummelten, als er dann später in seinen Büchern behaupten würde. Ich fühlte mich indiskret bei vielen meiner Wahrnehmungen, entschuldigte mich aber vor mir selbst damit, daß ich mich nach solchen Wahrnehmungen ja nicht gedrängt hatte, und ein bißchen grinsen mußte ich natürlich obendrein über den Voyeur, der seine Schwäche ja indirekt schon öfters in seinen Büchern eingestanden hatte. Ich war aber doch verblüfft, als er mich bei einem Nachmittagsbesuch, als ich allein kam, als erstes fragte: „Wo haben Sie ihre Freundin gelassen?“ Woher wußte der Mann, daß meine Freundin mit mir in Bargfeld war? – : Weil er mit besagtem Fernglas uns verfolgt und gesehen hatte, daß sich meine Freundin zum Sonnenbaden an den Waldrand drapiert hatte, als ich mich zu Schmidt aufmachte. Damit ließ er mich indirekt wissen, daß er uns beobachtet hatte; vielleicht war er auch nur enttäuscht, daß der Besucher keine Dame zum Charmieren mitgebracht hatte. Denn Schmidt, der sich unter Menschen oft so ungelenk und unsicher und eben deshalb wohl bisweilen so aggressiv und auftrumpfend benahm, machte auf Frauen großen Eindruck; jahrelang kursierten im Rowohlt-Verlag Erzählungen davon, daß die Damen des Verlages absolut ‚hin‘ waren von Schmidt und (zum Ärger Alices) an seinem Mund hingen und seine Stimme bewunderten, als er 1949 oder 1950 das Haus besuchte. Als bei einem Besuch in Bargfeld Jürke Grau und ich unsere Freundinnen dabei hatten, bat er uns alle – es war schon 7 Uhr abends – nach einem langen Nachmittagsspaziergang noch zu sich ins Haus: „Was machen Sie denn jetzt noch? Kommen Sie doch noch ein bißchen rein!“ Unsere Verblüffung war nicht klein; total perplex aber war Alice Schmidt, die nur noch hauchen konnte: „Aber Arno, Du wolltest doch noch…“. Er aber, aufgeräumt und sie leicht an der Schulter berührend: „Ach Lili, laß doch!“ Schmidt führte uns und dann immer ausschließlicher die Damen durch Haus und Bibliothek, erkundigte sich angelegentlich danach, welche seiner Bücher bzw. welche Sonderdrucke von seinen Sachen sie noch nicht hätten, suchte diese heraus, signierte sie – und wir Herren schauten durch die Röhre: Wir bekamen nichts, die Damen aber lauschten ihm intensivst, und Schmidt genoß, daß wir, Jürke und ich, grau vor Neid und Eifersucht waren. Ein Entertainer, nicht zuletzt, und nicht nur in seinen Büchern!
Ein paar Mal konnten wir Schmidts mit dem Auto zu langen Spazierfahrten abholen, einige Male auch zu Spaziergängen. Die Richtung ergab sich durch die Schauplätze einiger Passagen von „Kaff auch Mare Crisium“ und vor allem des Bandes „Kühe in Halbtrauer“, zum Teil auch schon durch die Schauplätze von „Zettels Traum“, die Schmidt verriet: Schauerfeld! Wir liefen also das ganze Schauerfeld von Ost nach West ab – „Am liebsten hätte ich hier noch eine Hütte zum Schreiben. Manchmal ist es mir im Dorf zu laut.“ –, fuhren durch Wälder der Südheide in Richtung der Fischteiche von Räderloh, und Schmidt gab exakte Anweisungen, welche Szene in seinen Büchern wo angesiedelt sei und was wir photographieren sollten: diesen Abhang wegen einer Szene im „Kundischen Geschirr“, eine Baumgruppe wegen dem „Ballonwettstreit“ in selbiger Erzählung, die Wacholderbäume wegen des zweiten Kapitels von „Zettels Traum“ namens „In Gesellschaft von Bäumen“, und zu Hause auf seinem Grundstück war die Kamera dann auf ein Holländerpüppchen und auf einen Glaskrug zu richten, der – der Wissende weiß! – als „ONE-GALLON-Krug“ eine tiefsinnige Rolle in der Erzählung „Caliban über Setebos“ spielt. Beim Gang übers Schauerfeld hatte er selbst wadenhohe Gummistiefel an, wir aber, die wir nicht gewußt hatten, was uns erwartete, konnten nur barfuß mit hochgekrempelten Hosen durch Bäche und sumpfiges Wiesengelände waten. Schmidt ungerührt und leicht grinsend bei unserem Anblick: „Ja, der Dienst der Musen ist ein beschwerlicher!“
Und ich photographierte und registrierte. Manchmal, wenn Jürke dabei war, schauten wir uns an: Mit welchem leise komischen Eifer Schmidt den Cicerone in seiner (‚seiner‘) Landschaft spielte! Und war denn das wirklich wichtig, Bäume, Sträuchergruppen und Whiskey-Krüge abzulichten? Aber wir hatten ja wahrhaft nichts Besseres zu tun, die Atmosphäre war nett, die Sonne strahlend, die Gegend hübsch, Frau Schmidt freundlich, Schmidt spaßig souverän und pseudoangewidert von der Weinbrandflasche mit „Alte Kanzlei“, aus der Jürke und ich uns bisweilen einen Schluck genehmigten. Über diesen Tadel des keuschen Dichters mußten wir nun unsererseits grinsen: Hatten wir ihn nicht einmal mittags um 12 zum Spaziergang abgeholt und er kam uns mit einer Alkohol-Fahne von ca. 1 Meter Länge entgegen? Gleichgültig, ob das alles in einem strikten Sinn literaturwissenschaftlich wichtig war, was wir da sahen und hörten: es gehörte zum Umkreis dieses eindrucksvollen Mannes und seiner so imponierenden wie skurrilen Existenz, und jedenfalls entzückte uns der Einblick in den Prozeß, wie da Literatur und Details der Landschaft als Material einbezogen wurden in das Zusammenmontieren und Einschmelzen von Schnitzeln und Accessoires zu Erzählungen, die zum Vertracktesten, Hintersinnigsten und auch Komischsten gehören, das die deutsche Prosaliteratur nach 1945 kennt. Es war einfach höllisch spannend, von ihm am 19.8.1967 zu hören, „Zettels Traum“ sei jetzt zu 5/8 schon gediehen, am 19.8.1968, das Buch sei jetzt zu 7/8 fertig – und im August 1969 erzählte er, er sammle schon Material zu dem Roman „Die Atheistenschule“, der werde, wie er sagte, „etwas umfangreicher als die ‚Gelehrtenrepublik‘“.
Am konzentriertesten, am fixesten, gewissermaßen professionell ging es zu, wenn ich ihm Fragen stellte – meist oben in seinem Haus, mit Blick ins Grüne im Norden und Osten; erst später arbeitete er dann in einem beigestellten Wohnwagen (wenn ich das richtig mitgekriegt habe), dann unten in seinem Holzhaus, noch später in dem feuersicheren bunkerähnlichen Haus, das er sich bauen ließ – und wenn er mir von sich aus allerlei Hinweise zu seinen Büchern gab, gewissermaßen um mich heiß zu machen, aber auch um mich für meinen Sucher-Eifer zu belohnen. Der Deutschlandfunk werde demnächst die „Finnegans Wake“-Sendung wiederholen, Frankfurt in vier Wochen eine halbe Stunde über seine, Schmidts frühesten Lektüreeindrücke senden – es gehe natürlich um Jules Verne, sein erstes großes Leseerlebnis. – In Trier habe mal eine Buchhändlerin auf Anfrage erklärt: ja, den Roman „Kaff auch Mare Cristum“ (!) führten sie – so katholisch sei die Gegend dort hinten! – Übrigens sei er, Schmidt, beinahe mal Küster in St. Jürgen bei Lilienthal geworden: Er als Atheist? Och, als Prediger wäre er schon einsetzbar gewesen, das hätte er schon gekonnt – geradezu bauchrednerisch! (Übersetzen sei ja auch eine Art Bauchrednerei.) Er würde den Bauern schon kräftig ihre Sünden vorgehalten haben! – Tja, ein Funkfeature über Karl Simrock bzw. das Amelungenlied sei auch noch fällig, das habe schließlich zu seiner frühesten Jugendlektüre gehört! Er denke auch an ein weiteres Funkfeature über Cooper: „Über Motti bei Cooper“, die Arbeit daran sei schon weit gediehen, und dann werde es gewißlich noch ein Feature zu Bulwer geben. – Unter seinem Tisch stehe seit Sommer 1969 eine Ledertasche mit einem Mikrofilm, auf dem „ZT“ abgelichtet sei, samt einigen bereits fotomechanisch reproduzierten Probeseiten des Buchs – für den Fall eines Brandes. Denn da sei einer im Dorf, welcher… – Harold Mortlake & Co, 24 Cecil Court, Charing Cross Road, London WC 2 empfehle er mir als ausgezeichnetes Antiquariat für Literatur des 19. Jahrhunderts. Er empfehle dito das Antiquariat Pirngruber in Linz, tolle alte Bücher und moderate Preise! – Stuttgart: Dort sei er 1951 mal mit Herbert Eisenreich, Alfred Andersch und Ernst Kreuder zusammengesessen (in der Erinnerung von – man höre und staune! – Helmut Qualtinger waren auch noch er, Qualtinger, und Max Bense dabei!). Bense sei vor einiger Zeit da gewesen, habe vor dem Tor gelärmt, um eingelassen zu werden, dann habe er ein Stück aus „Zettels Traum“ für die (bekanntlich eher kleinformatige) REIHE ROT haben wollen. Da habe er, Schmidt, ihm eine Seite von „Zettels Traum“ gezeigt, darauf Bense in seinem Kölner Dialekt: „Ja, also dat jeht wirklisch nisch!“ Schmidt lachte spöttisch. – Das Projekt einer Auswanderung nach Irland, an dem auch Andersch und Bölls beteiligt gewesen seien, sei ihm am Ende doch zu windig gewesen und zu versponnen. Ich ergänze: Für einen Schriftsteller ist es ja auch so eine Sache, von der Entwicklung der alltäglichen eigenen Sprache abgeschnitten zu sein. Schmidt: „Ja, als junger Autor! Aber ich bin autark. Ich wäre froh, wenn ich das Geschwätz hier in Deutschland nicht mehr hören müßte.“ – Über Hans Henny Jahnn: Den hat mal einer einen glasklaren, nüchternen Geist genannt. Also, vier Mal habe er ihn gesehen, und jedesmal war er tüdelblau! Er konnte dann allerdings ganz entzückende Sachen sagen wie zum Beispiel: „Ich kann nur zwei Sprachen: Plattdütsch un Lateinisch!“ – Im Gespräch über die künstliche Befruchtung der Kühe – „Irgendwie bedauer’ ich die armen Kühe. Ham gar nichts mehr davon!“ – fällt ihm ein, daß er 1950 bei der Mainzer Preisverleihung zwischen Alfred Döblin (links) und Pascual Jordan (rechts) saß, und da habe ihm der eiskalte und widerliche Pascual Jordan erzählt, daß man in der Nähe von Bonn schon unterirdisch Menschensamen lagere – wegen dem Atomkrieg, und damit es ‚danach‘ weitergehen könne. – „Ich muß meine Frau zur Witwe erziehen. Tu ich auch. Ich hinterlasse ihr aber auch was, wovon sie leben kann.“ Ja, die in „Dya Na Sore“ auf S. 132 erwähnten Projekte gibt es. „Tandemfahrten“ ist kurz, „Lilienthal“ wird lang, „Stützpunkt“ ist eine „60-80-Seiten-Sache“, „Polizeischule“ ist kurz – wieder so verflucht schwebend formuliert, daß man nicht wußte, ob die Texte schon geschrieben oder erst noch zu schreiben waren. – Leopold Schefer sei ein interessanter Mann, eigentlich müsse man den Nachlaß in Görlitz genauer untersuchen: „Mal ein halbes Jahr exzerpieren, daß die Fetzen fliegen!“ – Poe habe von Heinrich Clauren wissen können durch den Almanach „Vergißmeinnicht“, 1825 in London bei Ackermann publiziert, mit einer Clauren-Übersetzung!, – und daher sei eine Poe-Erzählung von Clauren beeinflußt. – Finde man irgendwo Veröffentlichungen über Schmidt, so solle man bitte eine Kopie an Frau Schmidt schicken. – Die irgendwo in „Kühe in Halbtrauer“ genannte Erzählung „Pharos oder von der Macht der Dichter“ von ihm selbst sei noch erhalten, er habe sie 1941 als Soldat in der Garnison Hagenau im Elsaß geschrieben. (Dies mit ganz festen Worten gesagt, was ja doch bemerkenswert ist angesichts dessen, was wir heute über den höchstwahrscheinlich späteren Entstehungszeitpunkt wissen, wenn auch das genaue Entstehungsdatum immer noch ein Rätsel ist.) – Nachts bzw. frühmorgens höre er auf seinem Nordmende oft Moskau und Havanna und den BBC und DDR-Sender; die entfernteren Sender verschwänden übrigens 1 Minute nach Sonnenaufgang allesamt und ganz schnell… ja, Spanisch verstehe er einigermaßen, habe er mal auf der Schule im Wahlunterricht gemacht. – Was ihn störe, sei das rote Blinklicht des Sendemastes von Bokel, 15 km nordöstlich von Bargfeld über der Waldborte. – Der Stahlberg-Verlag, d.h. Ernst Krawehl, habe damals, 1958, „Fouqué und einige seiner Zeitgenossen“ nicht haben wollen. Da hätte ihn Bläschke in Darmstadt genommen, und erst dann habe Stahlberg auch 400 Exemplare davon gemacht, die schnell weggingen, sogar die 50 ledergebundenen. Heute sei Krawehl jederzeit zu einer Neuauflage bereit, tja! – Ganz recht: Die Intention der Erzählung „Tina oder über die Unsterblichkeit“ sei Namens-Rettung gewesen, nur ironisch versteckt und verdreht. – Er habe den Artikel über Karl May in der NDB geschrieben – das wisse ich nicht? – : „Ich hab ja schon auch einen studienrätlichen Teil in mir; ich hab nicht umsonst die ganzen Lexika vor mir auf dem Tisch stehen!“ – Natürlich sei der Hintergrund für die IRAS-Insel in dem Roman „Die Gelehrtenrepublik“ die Künstlerkolonie in Darmstadt, wo keiner arbeite, und der einzige, der arbeite, sei er selbst – das Ganze eine Wunschprojektion aus der Darmstädter Atmosphäre in die Bargfelder Zukunft. – Besonders studierenswert sei der Briefstil der maid servants Winifred Jenkins und Tabitha Bramble in Tobias Smolletts „The Expedition of Humphrey Clinker“, denn da seien schon Verschreib-Techniken bzw. Wortspiele vorgeführt, die erst recht im 20. Jahrhundert bei Carroll und Joyce … – Johann Gottfried Schnabel sei spätestens 1760 gestorben, denn in einer Kirchenbucheintragung von 1760 werde er „weiland stolbergischer Hofbarbier“ genannt … – Wie spreche man übrigens den Namen von Sir Samuel Pepys aus? Etwa so, als werde er „Peeps“ geschrieben? Sei der Name schon im 17. Jahrhundert so gesprochen worden? – Nein, der Steckbrief aus der Erzählung „Die Wasserstraße“ könne natürlich nicht von 1963 sein, sondern … aber das verrate er nicht. – Wezels „Belphegor“ mit Nachwort von Hubert Gersch erscheine demnächst bei Insel wieder. Auf einem Gang zurück vom Schauerfeld nach Bargfeld: Daß er, Arno Schmidt, noch lebe, sei übrigens pure Glückssache. Auf der Rückverlegung von Norwegen nach Deutschland im Januar 1945 sei ihm in einer Woche drei Mal das Transportschiff unter dem Hintern versenkt und er mit knapper Mühe aus dem Wasser gefischt worden und nach Deutschland zurückgelangt; später dann, im Februar 1945, sei er obendrein noch beinahe vors Kriegsgericht gekommen, weil ihm irgendwelche Kontrollposten seinen Marschbefehl nach Schlesien nicht glauben wollten. Sei aber noch mal gutgegangen. Ja, „Kühe in Halbtrauer“ bzw. dies eine Motiv in der Geschichte, die Sache mit den 200 Schuß, die einer befehlsgemäß im April 1945 hätte „auf Vechta“ legen sollen, bei den Schlußkämpfen im Westen, sei nicht erfunden, das sei ein eigenes Erlebnis gewesen; sein einziges bißchen Widerstand habe darin bestanden, daß er die 200 Schuß einfach irgendwo ins Gelände habe legen lassen. Die Erlebnisse gegen Kriegsende seien überhaupt unangenehm gewesen. Mit seinen Geschützen habe er als Artillerie-Unteroffizier im westlichen Niedersachsen in der Bedeckung eines Bauernhofes gestanden, habe aus dem Hof heraus geschossen, der an drei Seiten geschlossen war, ein bißchen Deckung also bot gegen die Flugzeuge der Engländer. Vier Geschütze hatte er da noch, jedes hatte eine andere Rohrlänge, die Rohre waren überdies ausgeleiert, so daß man die Geschoßbahnen gar nicht mehr richtig berechnen konnte, und fünfzig Verwundete hatten sie auch in dem Bauernhof einquartiert. Der Bauer und seine Knechte waren stocksauer und gingen mit Mistgabeln auf die Soldaten los; „da konnte ich die nur noch zur Räson bringen, indem ich mit einer sog. sechsten Ladung schoß“ – der Effekt war, daß sämtliche Fenster in dem Bauernhof rausflogen: „Da wurde der zahm. Wissen Sie, ich hab ja sowas auch nicht gern gemacht, aber die Verwundeten mußten da liegen und ich brauchte Bedeckung zum Schießen. Ein rabiaterer Typ hätte den einfach an die Wand gestellt, das war am Ende des Krieges gang und gäbe, nicht wahr. Aber das wollte ich um Gottes Willen auch nicht tun.“ (Es hat in letzter Zeit Spekulationen über eben diese oben erwähnte Szene mit den „200 Schuß auf Vechta“ gegeben; vgl. Lars Clausens Aufsatz „Axiomatisches in Arno Schmidts Weltmodell“, in: Hefte zur Forschung, Heft 1, Bargfeld 1992, S. 53 ff., insbesondere S.60 f). Ich habe mir die Abschrift der Tonbandaufzeichnung, die ich gleich nach dem Gespräch mit Schmidt im August 1967 gemacht habe, nochmals angesehen: Schmidt hat definitiv gesagt, daß er selbst derjenige war, von dem es in der Erzählung heißt, er habe in einem kleinen Akt des Widerstands befehlswidrig die 200 Schuß nicht auf, sondern neben Vechta gelegt. Nichts hätte Schmidt daran gehindert, auf meine Frage zu sagen, dies sei eine erfundene Geschichte bzw. er selbst sei nicht mit dem Ich-Erzähler von „Kühe in Halbtrauer“ identisch (oder jedenfalls nicht in dieser Hinsicht). Er hat aber ausdrücklich gesagt, daß er das war. Nun kann er mich natürlich angelogen haben. Dann aber ist eben dies festzuhalten: Daß er 1. eine Geschichte schreibt, in der einem Ich-Erzähler zugeschrieben wird, er habe diesen Trick des Unterlaufens eines Befehls angewendet, und daß er 2. auf Befragen bekräftig, daß dies ein real-biographisches, außerliterarisches Faktum seines eigenen Lebens sei. Wie wär’s übrigens, es erforschte mal jemand, ob im April 1945 überhaupt 200 Schuß auf Vechta gelegt worden sind? Solche 200 Schuß müßten auch in den letzten Kriegsmonaten eine Markierung für die Geschichte der Stadt sein, von der sich irgendwo Dokumente finden müßten. So oder so hätten jedenfalls wahrscheinlich die betreffenden Spekulationen ein Ende bzw. es müßte neu überlegt werden, ob es wirklich eine singuläre und eigene Untat war, die Arno Schmidts Weltmodell in der Spätphase des Krieges um ein so schockierendes Axiom bereichert hat…). – Bei Gesprächen oben in seinem Arbeitszimmer immer wieder Blicke hinaus ins Grüne, etwa ein langer schweigender Blick durchs Ostfenster auf den Garten. Es war Herbst. „Schauen Sie mal, wie die Föhren leuchten!“ Die Föhren sahen wirklich schön aus in ihren Herbstfarben, aber ich überlegte mir doch, ob diese lyrische Interpunktion unseres Gesprächs nicht wieder arg nach Inszenierung und einer Pose der Nachdenklichkeit klinge. Es war schon so, wie Wilhelm Michels sagte: „Bei vielen Sachen, die er sagt, weiß man nicht recht, ob er das nun ernst meint.“
Nur einmal sah ich ihn stutzen und unangenehm verblüfft inne halten. Das war, als ich in einem Gespräch über Sigmund Freud – der ihn in jenen Jahren seit spätestens 1962, da er seine ganze Schreibtechnik und seinen Literaturbegriff umstellte, ja sehr interessierte und dessen Psychoanalyse wohl neben dem Werk von James Joyce den umstürzendsten Einfluß auf seine Literatur hatte – anmerkte, daß ich selbst in Psychoanalyse sei und 300 Stunden hinter mir hätte. Das ließ ihn stumm und besorgt innehalten. Später erzählte er irgendwas von einem moorigen Gebiet östlich von Bargfeld, in dem schon einige Leute verschwunden seien … Ich sagte etwas wie: „Na, das ist ja eine ganz schön harte Geschichte.“ Schmidt darauf: „Nicht nur eine Geschichte. Sie wissen ohnehin schon zu viel.“ Ich lachte. Heute denke ich, daß dies ein erstes kleines Indiz dafür war, daß er fürchtete, mir doch zu viele Gelegenheiten zu psychologischen Beobachtungen zu geben, und daß er das Gefühl bekam, mir mehr auch über Details seiner Texte verraten zu haben, als ihm bei genauer Überlegung lieb sein konnte. Ich denke, daß Selbstsicherheit und Unsicherheit bei Schmidt ganz eng benachbart waren; er wußte, wie er einem imponieren konnte, aber er war intermittierend auch wieder sehr unsicher, hatte Angst, sich nicht richtig benehmen zu können, und wer weiß, wie unmöglich er sich 1964 in Berlin benahm nach der Verleihung des Fontane-Preises (was ihm selbst ja nicht entgangen sein kann, worauf auch Walter Höllerers Erzählungen von dieser Peinlichkeit deuten), der kann nur schließen, daß er vielleicht ein ähnliches Fiasko 1973 in Frankfurt vermeiden wollte und nicht zuletzt deshalb seine Frau zur Entgegennahme des Goethe-Preises und zur Dankesrede entsandte.
Ich habe Schmidt auch kaum je essen und trinken sehen, am ehesten noch in kleinem Kreise bei Wilhelm Michels, der seit 1967 in Bargfeld wohnte und bei dem Schmidts zwei, drei Jahre lang sozusagen einen Mittagstisch hatten. Schmidt hielt Essen wohl für eine Zurschaustellung einer körperlichen Funktion, deren er sich schämte – nicht zuletzt, weil er befürchtete, diese Tätigkeit nicht recht zivilisatorisch gezähmt zu haben; verräterisch sein Bonmot, beim Essen sei er ebenso ungern in Gesellschaft wie beim Gegenteil. So saßen wir einmal nachmittags bei Michels an einer großen Kaffee-und-Kuchen-Tafel; es war sonnig und lustig und alle schwatzten, und dazwischen nahmen wir auch einen Cognac, Schmidt allein aber saß würdig, wortkarg und steif da und hatte ein Glas Wasser vor sich, an dem er nippte. Das war reine Show, fast clowneske Pose, aus Unsicherheit geboren und vielleicht überlagert von dem Spaß, die Pose des völlig vergeistigten reinen Dichters vorzuführen („Es ziemt dem Dichter, keusch zu sein, nicht aber seinen Versen“), jedenfalls aber das extreme Gegenteil davon, daß Schmidt gerade bei längeren Spaziergängen die Fassade auch vergessen konnte, hinter der sich zu verstecken ihm fast zur zweiten Natur geworden war; mit entspannten, fast weichen Gesichtszügen, die Hände in den Hosentaschen, witzige Bemerkungen über alles und jedes in die Gegend streuend lief er dann mit uns herum und hatte seine Menschenscheu und sein puritanisches Arbeitsethos – „Ich bin Pedant und Puritaner“ – so offensichtlich vergessen, daß Jürke Grau nach dem ersten Besuch, den wir zusammen bei Schmidts machten, ganz verblüfft sagte: „Der und menschenscheu oder weltscheu! Der ist doch aufgeschlossen und locker!“
Langsam tauchten auch gewisse politische Spannungen im Gespräch mit ihm auf. Schmidts schafften sich Ende August 1969 einen Fernsehapparat an, und damit waren sie auf eine paradoxe Weise in ihrem Bargfelder Refugium doch wieder mit der Welt verbunden und malten sich ihr Bild der bundesrepublikanischen Gesellschaft nach Maßgabe der Teilnahme am sozialen Leben via Fernsehen. Das Resultat war fatal und ist ja auch in Schmidts Büchern, besonders in „Zettels Traum“ zu besichtigen, in Spuren sogar noch in „Abend mit Goldrand“. Die aufmüpfigen Studenten avancierten zu den wichtigsten Sündenböcken; deren Unruhen zeigten – Schmidts zufolge – doch nur, daß sie „Anarchisten“ waren und gerade durch ihr anarchistisches Gebaren die einfachen Leute der NPD in die Arme trieben; die Arbeiter wiederum wollten „nicht mehr arbeiten“, sich aber auch nicht „bilden“ und „keine Sprachen« mehr lernen, bevor sie „auf Urlaub ins Ausland fahren“… Die Herren der Großindustrie aus dem feinsinnigen und spendablen „Kulturkreis im Bundesverband der deutschen Industrie“ avancierten nun für Schmidt plötzlich zu den einzigen kulturell noch Verantwortlichen, den echten Mäzenen; er begriff weder die moralische Katastrophe des Vietnamkrieges als eine der Ursachen des studentischen Protests, noch die Katastrophe der russischen Besetzung der Tschechoslowakei am 21. August 1968. Diesen Tag erlebten wir übrigens in den Sommerferien in Bargfeld, und die Mitteilung von Herrn Frommhagen in Hagen (bei Sprakensehl), wo wir in diesen Tagen wohnten, am Morgen des 21. August: Wir freuten uns hier über die Sonne und in Prag seien am frühen Morgen die Russen einmarschiert, werde ich nie vergessen. Am Nachmittag kamen wir nach diesen deprimierenden Morgennachrichten zu Schmidt, der kühl, pseudo-weise und mit betont abgeklärter Skepsis erklärte, man wisse nicht, was da eigentlich gespielt werde. Wir waren entsetzt, wie jemand, den wir einmal für links gehalten hatten und dem die deutsche Literatur doch ein kritisches und extrem präzises Bild der gesellschaftlichen Zustände der BRD in den vierziger, den fünfziger und zum Teil auch noch den sechziger Jahren verdankt, politisch so schnöde abdanken konnte. Was zum Vorschein kam, war wohl, daß Schmidt durch seine Erfahrungen im Dritten Reich gewissermaßen anpolitisiert worden war, aber keineswegs ein auch nur einigermaßen konsistentes politisches Bewußtsein, weder früher ein linkes noch später ein rechtes, ausgebildet hatte; im übrigen interessierte er sich wohl ohnehin von Anfang bis Ende wirklich nur für seine Literatur … Und zweitens richtete sich die Kulturkritik der Studentenbewegung ja offensichtlich auch gegen die „unfragliche“ Würde von Kunst und allen bürgerlichen kulturellen Werten – und in dieser Hinsicht konnte, da nun plötzlich nicht Sublimierung im Namen der Schaffung kultureller Werte gefordert, sondern fröhliche Entsublimierung gefeiert wurde, wirklich jemand, der sich der jahrelangen Sklavenarbeit der Herstellung eines Über-Buches von 1334 Seiten namens „Zettels Traum“ unterzog, keinen Spaß verstehen (auch wenn gewisse Teilaspekte etwa der Liberalisierung der Sexualität ihn nicht nur beunruhigten, sondern sogar versteckt sehr sympathisch berührten). „Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein“, sollte nach der Fertigstellung von „Zettels Traum“ Schmidts großer Trost sein, und just der Trost dieser Unsterblichkeit wurde nun in Frage gestellt! Wenn in dieser Lage der Bundesverband der Industrie noch Kulturpreise verteilte, so waren Banausie und Kulturgefährdung jedenfalls ihm nicht anzulasten. Ich machte über den Schmidt 1969 zugesprochenen Preis eine Bemerkung à la „Das Geld muß man den Herren auf jeden Fall abnehmen; es ist ja ohnehin eigentlich nicht deren Geld.“ Schmidt darauf, gelassen: „Ach wissen Sie, so gehässig denke ich gar nicht.“ Gehässig hatte ich es nun auch nicht gemeint, aber Eigentumsfragen standen damals mit gutem Grund auf der Tagesordnung, und das verunsicherte den eben zu einem Häuschen und einem Grundstück und einem Preis gekommenen Schmidt, der sein Publikum plötzlich eher bei den soignierten Herren des Kulturkreises als bei der zunehmend bärtigen Jugend sah – insgesamt übrigens wohl doch fälschlicherweise. Daher also solche Pronunciamentos Schmidts, die mich (und nicht nur mich) endgültig veranlaßten, den Künstler Schmidt vom politischen Denker zu trennen. „Die Großindustrie kann fest auf mich zählen!“ sagte er – das also im Jahr 1969 von dem Antimilitaristen Arno Schmidt, dem Adenauer-Hasser, dem Antiklerikalen, der einst gesagt hatte, für die Kommunisten sei er Sozialdemokrat, für die Sozialdemokraten aber Kommunist.
Wer das ‚Weltbild‹ des späten Schmidt dereinst untersuchen will, wird nicht darum herumkommen, diese Strukturierung der Weltwahrnehmung Schmidts durch das Fernsehen zu durchdenken. Fragmentarisiert und in einem für sein Wahrnehmungs- und Ordnungsvermögen wahnwitzigen und desaströsen Tempo wurden Schmidt die Weltereignisse ab 1969 vor Augen geführt; das Resultat war eine sich verstärkende Neigung, die Welt des Politischen nur noch als eine Art Affenzirkus und Narreteien-Kabinett zu sehen und auf Konkretion und Differenzierung zu verzichten. Dabei blieb eine ruhige Unterscheidungsfähigkeit Schmidts auf vielen Gebieten immer intakt; wenn man in den sechziger Jahren eine spitze Bemerkung über die Bauern und ihre hohen Agrarsubventionen machte, konnte Schmidt bedächtig-verstehend antworten, die Bauern gingen von ganz bestimmten Erfahrungen und Interessen aus, die seien halt auch im 3. Reich gepäppelt worden, und vor diesem Hintergrund … Was mir gar nicht unsympathisch war, vor allem da Schmidt unter den Dörflern als offenbar ganz handfestes und verständig mit ihnen plauderndes Mannsbild galt, auch wenn er nicht am Tresen von Bangemanns Gasthaus erschien; er hörte sich Wetter- und Erntesorgen an und spendete ordentlich für die Freiwillige Feuerwehr; Frau Alice Schmidt dagegen wurde wegen ihrer Art, die als hochmütig und von-oben-herab empfunden wurde, wesentlich weniger geschätzt.
Alles scheiterte dann am Ende an besagter Eigentumsfrage, könnte man sagen, aber das stimmt auch nicht ganz. Bei allen meinen Besuchen bei Arno Schmidt stand im Hintergrund das Über-Buch „Zettels Traum“, für das er die Materialsammlung 1963 begonnen hatte und die Niederschrift 1965; Anfang 1969 schloß er die Niederschrift ab, im April 1970 erschien der Brocken, der – wenn er auch nur quantitativ Schmidts Werk krönt (man könnte ebenso gut sagen: erdrückt; vgl. meine Überlegungen in dem Aufsatz „Eine Momentaufnahme, ein Scheideblick. Arno Schmidts ‚Zettels Traum‘“, neue deutsche literatur 40. Jg./1992, Heft 11, S. 110 ff.) – doch einen der Gipfelpunkte der westdeutschen Nachkriegsliteratur darstellt. Die Stunden für Besucher in diesen Jahren knappste sich Schmidt ab von seinem Arbeitspensum an „Zettels Traum“, und das Erstaunliche ist, daß Schmidt, wie gesagt, dennoch meist entspannt und zum Teil fast heiter wirkte. Seinem Verleger bzw. Lektor und Impresario Ernst Krawehl hatte ich auf der Buchmesse 1969 gesagt, er solle nicht nur 2000, sondern 3000 Exemplare drucken lassen von „Zettels Traum“, 3000 würde man auf jeden Fall verkaufen, denn das Buch werde eine solche Kuriosität darstellen, daß auch spekulative Käufer das Objekt zu einem Erfolg machen würden. Der Verlag druckte aber nur 2000 Exemplare, mit der Folge, daß schon nach drei Monaten alle Exemplare weg waren und alle, die ein bißchen gebraucht hatten, um die 245 Mark zusammenzusparen, welche das 9-Kilo-Buch kostete, die Dummen waren. Als in diese Bresche die Berliner Raubdrucker sprangen – lesen Sie demnächst hierzu das historisch aufschlußreiche Interview mit dem damaligen Chef-Raubdrucker im „Bargfelder Boten“! –, die bei ihrem Unternehmen vor allem ein Stück Elite-Kultur „sozialisieren“ wollten, so daß dieser Raubdruck von „Zettels Traum“, dem Zug jener Jahre folgend, gewissermaßen als anarchisch-antielitäre Tat zu betrachten war, sagte ich das öffentlich und deutlich in einer Glosse in der Süddeutschen Zeitung: daß das Copyright damit klar verletzt sei, es sich aber doch um eine Tat für Besitzer schmaler Geldbeutel handle. Das nahmen mir Schmidts noch gar nicht so übel, vor allem, da ich ja ohnehin nicht der erste war, der den Raubdruck meldete und kommentierte. Schmidt verhandelte sogar mit einem Emissär der Raubdrucker und hielt dem vor allem vor, ein verkleinerter Raubdruck des Originaltextes werde nicht mehr gut lesbar (!) sein. Erst als Schmidt, der sich durch den Raubdruck vielleicht zu einem gewissen Grade sogar geschmeichelt fühlte, ganz klar wurde, daß sein Verlag S. Fischer den Raubdruck sehr ernst nahm, weil kein Buch von Schmidt mehr in Zukunft sicher kalkulierbar sein würde, da ja bei jedem Titel ein Raubdruck drohen könnte, verfolgten Schmidt und vor allem Frau Alice, der ich wohl ohnehin nicht ehrerbietig genug begegnet war, auch mir gegenüber eine neue Politik. Und die hieß: unausgesprochenes Besuchsverbot, ausgesprochen durch Sich-tot-stellen.
Die Art, wie er sich distanzierte, folgte dem bekannten Muster. Gewarnt war ich ja gewesen, wie gesagt, und ein Einzelfall war ich nicht; Schmidt machte gegenüber Helmut Heißenbüttel (da spielte irgendeine läppische Fahrkostenabrechnung des Süddeutschen Rundfunks die Rolle eines Vorwands) und Max Bense, gegenüber Wilhelm Michels und noch weiteren Personen (die Details sind mir in bestimmten Fällen nicht ganz klar) und schließlich auch mir zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ‚dicht‹, indem er – in Absprache mit seiner Frau – irgendeinen Vorfall, der normalerweise in einem Gespräch geklärt oder wenigstens offen hätte erörtert werden können, zum Vorwand nahm, die Beziehung abzubrechen. Dies Muster ist in seinen Beziehungen häufiger zu entdecken: Wenn ihm der Umgang mit jemand zu eng wurde, nicht mehr fruchtbar schien oder wenn seine Frau darauf drang, stellte er ihn ein – ein Anlaß dazu fand sich immer. Er genoß diese nicht genau besprochene Suspension von näheren Beziehungen wohl auch noch, mit einer Mischung aus Spielerischkeit, Sadismus und Feigheit. Im Sommer 1975 traf ich ihn zufällig am Badeteich in Bargfeld; ‚zufällig‘ heißt: Bargfeld und Umgebung sind so hübsch und ruhig, daß man inzwischen (und bis heute) bekanntlich auch ohne den Zielpunkt Schmidt dorthin fahren kann. Wir begrüßten uns also, unterhielten uns über dies und das, und schließlich sagte ich ihm, ich fände es albern, eine Beziehung so ungenau in der Luft hängen zu lassen: Welche Sünden ich denn eigentlich begangen hätte? Darauf er: „Das müssen Sie meine Frau fragen, die führt Ihr Sündenregister.“ Die wollte ich aber nun partout nicht fragen; sie plapperte auf weite Strecken nur auftragsgemäß das nach, was ihr Mann ihr aufgetragen hatte – und das hätte ich wie so mancher andere denn dann doch lieber im Originalton gehört. Was sie aber in seinem Namen auszurichten hatte, das vergiftete sie noch durch Zutaten, die unnötig waren und doch nur von ihrem Mann sich die Autorität borgten. Es war zum Beispiel nicht angenehm gewesen, von der des Englischen nicht sonderlich kundigen Frau Schmidt heruntergeputzt zu werden, weil man eine positive Rezension von Klaus Reicherts Übersetzung von Carrolls „The Hunting of the Snark“ geschrieben hatte: Wie komme man denn dazu, fragte Alice Schmidt, wo diese Übersetzung doch so schlecht sei?! – Hätte Arno Schmidt das gesagt, hätte man darüber streiten können; doch er war zu feige für solchen Streit, und mit ihr gab es da nichts zu erörtern: sie plapperte nur nach.
Diese Feigheit, Unsicherheit oder Bequemlichkeit war ein Zug an Arno Schmidt, der mir erst spät aufging, und ich hätte ihn doch eigentlich schon in eher kuriosen Kleinigkeiten seines Verhaltens bemerken können. Bei Spaziergängen hatte er immer das Fernglas vor der Brust, benutzte es auch häufig und schaute vor allem immer durch, wenn sich Leute am Horizont abzeichneten, klassifizierte diese sogleich und befahl zum Beispiel (ich hab’s mir notiert): „Heidekrautsammlerin mit zwei Töchtern. Rechts abbiegen, damit wir der nicht in den Weg kommen!“ Doch von dieser Erkenntnis fällt kaum ein Schatten auf die ersten der sechs oder acht Besuche bei ihm, die lebendig, temperamentvoll und gutgelaunt verliefen und während derer er erheiternd übertrieben grimassierte, sich ein bißchen über die Katzenliebe seiner Frau und anderer Dörflerinnen und über die eifrig eingeworfenen Zwischenbemerkungen seiner Frau amüsierte und das Posieren nicht lassen konnte. Das koppelte sich, wie Wilhelm Michels kopfschüttelnd diagnostizierte, aber oft unentwirrbar mit Ernstgemeintem, so etwa, als wir mit meinem alten VW auf den Sandwegen der Heide losfuhren und uns lebhaft unterhielten, wobei ich für einen Moment die Hände vom Steuer nahm. Gefährlich war das gar nicht, weil die Spurrinnen so tief waren, daß der Wagen nicht vom Weg abkommen konnte; Schmidt aber befahl: „Halten Sie an!“ Ich dachte: Au weh!, und hielt an, und Schmidt sagte strafend, pompös und so übertrieben wie komisch: „Nehmen Sie die Hände ans Lenkrad! Sie halten das Schicksal der deutschen Literatur in Ihren Händen.“ Er hatte mal wieder Gelegenheit gehabt, sich zu inszenieren und eine Anekdote zu produzieren.
Sicher hat bei einer Gruppe von Lesern einer bestimmten Generation im Verhältnis zu Arno Schmidt hochgradig eine Identifikation geherrscht, die einer psychoanalytischen Entschlüsselung und einer lesersoziologischen und leserpsychologischen Deutung noch harrt; man vergleiche hierzu auch die Überlegungen am Ende von Rüdiger Zymners Aufsatz „‚Kultlose Kultur‘. Arno Schmidts Programm der Isolierung“ im vorliegenden Heft. Doch auch wenn die ‚Nachfolge‘ des Meisters skurrile Züge getragen haben und so etwas wie ein Mini-George-Phänomen gewesen sein mag – psychologisch zu relativieren war und ist daran nicht alles; die Psychologie wäre gar nicht zum Tragen gekommen, wenn da nicht der überzeugende und begeisternde Eindruck gewesen wäre, daß Arno Schmidt entschieden für etwas stand, daß hier jemand seine Arbeit nicht relativierte, sich nicht dauernd in den Medien tummelte und feilbot und weder sich selbst noch seinen Lesern einen bequemen Rabatt gewährte.
Hier war jemand, der von der Literatur und ihrer höchsten Wichtigkeit absolut überzeugt war, der unzweideutig zu seiner Aufgabe stand und sich nirgends anbiederte. Zu einem Zeitpunkt, da immer mehr Autoren durchblicken ließen, Literatur sei eigentlich auch nicht eine so absolut und unzweideutig wichtige Sache und man müsse sich schon auch ein bißchen als flinker Medienbubi präsentieren, um durchzukommen, setzte Arno Schmidt allein auf die Durchsetzungskraft der Sache selbst, seiner Sache: der Literatur. Nun ist er für mich nicht nur in zeitliche Ferne gerückt, sondern auch seine Literatur hat sich für uns alle wohl zumindest dadurch relativiert, daß wir, nicht zuletzt einfach durch Lebensalter und zunehmende Lektüreerfahrung, noch andere bedeutende Autoren wahrnehmen lernten; verdächtig wär’s ja eher, wenn es anders wäre. Aber für mich wie für alle, bei denen seine einmalige Fähigkeit wirkte, eine Begegnung mit ihm und seinem Werk als etwas ganz Einmaliges zu suggerieren, nimmt er bis heute eine Ausnahmeposition ein, und der intensive Eindruck, den ich von seiner Person gewann, unterliegt einem nur langsamen fading (ein Ausdruck, den er in Gesprächen übers Abhören ferner Sender gern gebrauchte). Neben Gerhard Gershom Scholem war Arno Schmidt wohl der bedeutendste Mensch, mit dem ich in nahem persönlichem Umgang gewesen bin.
(Was war denn das entscheidende Bild jener verrückten Tage?! – : Es blitzt irgendwo ganz hell, ein snapshot: Da steht er in seinem Garten, grüne billige Hosen und so ein braunes Popelinejäckchen an, und darunter sein rotes Hemd, ein Kunststoffhemd, billigst, wahrhaft ein Bakkelithemd (hieß damals Nyltest oder Niletest oder so), Fernglas umgehängt, blank gewetzter Knotenstock in der Hand und fertig zum Gang entlang der Wasserstraße, wo er dann die Stellen zu kennen behauptet, an denen es im Schmalwasser noch Perlmuscheln gibt, doch er verrate sie nicht. Tja, Fouqué, Fouqué: „Wie bin ich bloß auf den gekommen? Naja, E.T.A. Hoffmann ist sicher der bedeutendere Mann, aber Fouqué … er war halt der einzige der Romantiker, der noch frei war, unverbiographiert…“. Was für eine Idee wieder, über einen Mann eine 800-Seiten-Biographie zu schreiben, eigentlich nur weil das Thema noch unbesetzt war!)
Jörg Drews: Those were the days, my friend, oder: „Zur Erinnerung an Ihren [= meinen] Werkstattbesuch“. Stunden bei und mit Arno Schmidt. Bargfelder Bote Lieferung 200 (16. Juni 1995), S. 43–61.
Siehe auch: Begegnung mit dem Genius. Besuche bei Arno Schmidt. In: Neue Deutsche Literatur, Berlin, 43. Jg. 1995, H. 1, S. 66–82.