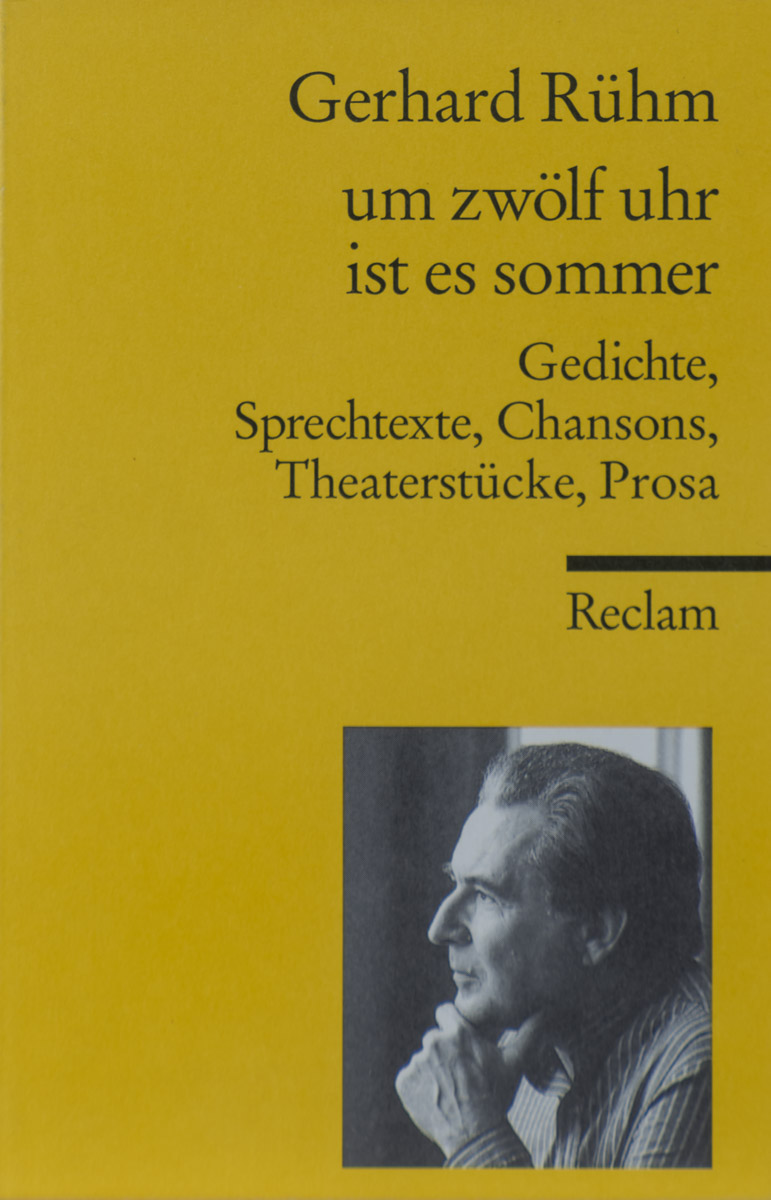Jörg Drews: „mia geds in da wöd zu oag zua!“ Gerhard Rühm sammelt seine Poesie aus zwanzig Jahren.
Zu einer Zeit, wo die Lyrik scheinbar noch blühte, in jenen Nachkriegsjahren, als eine Schwemme preziöser Genitivmetaphern durch die deutschen Gedichtbände brandete, Gottfried Benn über „Probleme der Lyrik“ sprach und es in jeder deutschen Stadt, die ein Gymnasium besaß, einige Oberprimaner gab, die sich für Benns Gedichte hätten in Stücke reißen lassen – zu jener Zeit waren sie in Wien schon am Werk, die Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm und Oswald Wiener. Sozusagen am damals Aktuellen vorbei griffen sie zurück auf Traditionen von Sprache und Lyrik, die nicht zuletzt durch das Dritte Reich verschüttet worden waren: auf Arno Holz, auf die Wortkunst des Sturm-Kreises, auf Schwitters und den Dadaismus. Die Zukunft dessen, was bis heute noch „Gedicht“ heißt, sahen sie in Möglichkeiten, die Benn zum Beispiel in seinem Vortrag „Probleme der Lyrik“ nur skeptisch und am Rande erwähnte, im Lautgedicht, in Quasi-Gedichten aus Vokabelreihen und, mit einer seltsamen Volte, die allerdings nicht regressiv, sondern „experimentell“ zu verstehen ist, im Dialektgedicht.
Was damals im Untergrund des österreichischen und ganz am Rande des deutschen Literaturbetriebs lief und nur in – fast sektiererischen – kleinen Zirkeln gelesen und diskutiert wurde, füllt heute stattliche Gesamtausgaben; was noch immer nicht umfassend rezipiert wurde ist heute schon klassisch und historisch geworden: Heissenbüttels „Textbücher“ (die ja manches aus den fünfziger Jahren enthalten), Gomringers Konstellationen, Claus Bremers Poesie, Achleitners Prosa, Montagen und Dialektgedichte, Artmanns Gedichte aus 21 Jahren und die Einzel- und Gemeinschaftsarbeiten der Wiener Gruppe. Nicht als ob da eine Seitenlinie der Lyrik sich verlaufen hätte, „Experimente“ „gescheitert“ wären – andere lyrische Spätlinge erlebten von vornherein nur eine Scheinblüte, wußten und wissen nur eben bis heute nicht, daß bestimmte poetische Sprechweisen unwiderruflich dahin sind. Aber eine Phase scheint zu Ende zu gehen, die Phase der „konkreten“, „avantgardistischen“, „experimentellen“ Poesie – wie immer sie auch rubriziert werden wird – scheint abgeschlossen zu sein; die diversen Sammelausgaben sind ein Indiz dafür.
Bezeichnend für die Arbeiten Gerhard Rühms aus den letzten zwanzig Jahren ist der große Umfang der Möglichkeiten, die Vielzahl der alten und neuen Gattungen, die er erkundete. Der Band mit seinen gesammelten Gedichten bringt Lautgedichte, Vokabulare, Dialektgedichte, Lautgedichte im Wiener Idiom, Textbilder und „dokumentarische“ Sonette – von den Thusnelda-Romanzen und den literarischen Chansons, die an anderer Stelle erschienen, aber in diesen Zusammenhang gehören würden, ganz zu schweigen. Rühm begann in den frühen fünfziger Jahren mit Lautgedichten, in denen von der Semantik abgesehen und allein die sprachliche Geste, die klangliche Expression als isoliertes Phänomen dargestellt wurde:
Uoaeif!
uoant!
uork!
uoaels!
ump!
Und wie er Klanggesten herstellte, das Gedicht auf Vokalbögen reduzierte, so suchte er in anderer Richtung danach, die Ausdruckskraft der Sprache durch das unvermittelte Nebeneinanderstellen einander ganz fremder Wörter unter Eliminierung aller Syntax wieder zu erweisen:
oper immi lama
fee kirgise resi
molekül sirenen
aurora schuhe beileid
schinken troubadur
silbenrätsel müll
kreide grog tschaikowsky
erbse feile eins
blei bier stern
Das ist kein „lyrisches“ Vokabular, das ist auch kein Gedicht, aber es realisiert einen Teilaspekt dessen, was einst „Gedicht“ hieß: das Einzelwort hat noch einmal die ganze Überraschungskraft, die ganze Bedeutungsschwere, die es in großer klassischer Lyrik hatte. Nur ist sozusagen nichts mehr dahinter, es ist pure verbale Oberfläche, Artistik, „Wortkunst“.
Der „Bedeutung“, den handfesten Inhalten wurde noch einmal Tür und Tor geöffnet, als Artmann, Achleitner und Rühm sich auf die Dialektpoesie warfen, als sie die Ausdrucksmöglichkeiten der Mundart noch einmal aktivierten, um sie unter den Auspizien von Surrealismus, schwarzem Humor und planmäßiger Provokation durchs Makabre zu einer letzten Blüte zu bringen. Die Gedichte bekamen durch die grellen, krassen, groben Themen aus dem Wiener Alltag noch einmal jene Substantialität, die die Lyrik verloren hat und die schon beinahe das Wort „Lyrik“ selbst zu einer feinsinnigen Peinlichkeit hat werden lassen.
Rühm hat der Dialektdichtung die deftigsten Effekte abgewonnen (Artmann mehr die im alten Sinn „poetischen“), indem er im „Selbstmörderkranz“ von 1955/56 in gut Wienerischer Tradition den Tod zum Generalthema machte und damit so etwas wie Lebensnähe und Plastizität erreichte:
Mia geds in da wöd
Zu oag zua
Drum hoob i a baggl
Schiassbuifa geschluggd
Und schbreng mi
In d ewiche rua
(Mir geht’s in der Welt / Zu arg zu / Drum hab ich ein Päckchen / Schießpulver geschluckt / und spreng mich / in die ewige Ruhe). Gerade durch die makabren, gewagten Themen und Motive hatte das noch einmal Saft und Kraft, doch künstlerisch avancierter sind eigentlich Rühms Dialekt-Lautgedichte, die nicht auf den blutigen Witz bauen, sondern das alltäglich mundartlich Gesprochene auf abstrakte Tonfälle reduzieren, auf Lautfolgen, die nichts sagen und dennoch unverkennbar wienerisch sind; man muß sich das breit und rüde intoniert denken, mit Verve prononciert:
gschleu moggn
desdei man
bauschn aung
graze glade bosd
schoggn kann
Und wie man bei solchen Gebilden akustisch-sprachmusikalische Phantasie mitbringen muß, um sie „abzuhorchen“, ihnen nachzulauschen, so setzt Rühm auf die visuelle Phantasie des Lesers, auf den Blick für Nuancen, wenn er „Textbilder“, Anordnungen von Buchstaben und Wörtern auf der Seite präsentiert. Ein Blatt, durch drei saubere vertikale Linien in vier weiße Felder unterteilt und mit dem einzigen säuberlich gedruckten Wort „winter“ im rechten Feld – das ist konkret-visuell der Winter, wo alles nur Schnee und ein paar schwarze Äste ist; das kann aber auch so ergänzt werden, daß in die drei anderen Felder von links nach rechts Frühling, Sommer und Herbst gehören, um die angetippte Reihe voll zu machen, und der Genuß liegt in der Verblüffung über „so wenig“ auf der Seite, das zugleich so vieles suggeriert.
Reichhaltig sind Rühms Beispiele für Konstellationen und Ideogramme; was er da erfand, ist variantenreicher als die relativ schmale Anzahl von Konstellations-Typen, die Gomringer realisierte. Das konsequenteste Produkt der „konkreten“ Wortkunst liegt allerdings sozusagen außerhalb der vorliegenden Sammlung; es ist Rühms konkretes Buch rhythmus r, wo die Konkretion bis ins Haptische zum Konstruktionsprinzip des Buches gemacht ist, wo nicht nur etwa von „Bart“ und „rasieren“ gesprochen wird, sondern dann auch ein Blatt zu fühlen ist, das – weil’s Sandpapier ist – so rauh ist wie ein unrasiertes Kinn. Ein Endpunkt der „konkreten“ Kunst, wie Rühms Zyklus von Dokumentarischen Sonetten wohl einen der Endpunkte der Sonettengeschichte markiert. Da wird ein ehrwürdiges poetisches Genre noch ein letztes Mal mit klapperndem Leben erfüllt, Reimschemata werden auf Teufelkommraus eingehalten und die Themen sogar höchst aktuell gewählt: was eben gerade in der Zeitung drin ist, wird gereimt:
Montag, 21.7.1969
Die ersten menschen sind auf dem mond
am sonntag, dem dem zwanzigstensten juli,
neunneunzehnhundertneunundsechzig, um
um einundzwanzig uhr uhr achtzehn um
sind sind die beidenden amerik- juli
kanischen astronauten neil neil juli
neil armstrong und und edwin aldrin um
an bord bord ihres raum raumschiffes um
um „adler“ auf dem mond gelandet juli.
in der geborgenheitheit ihrer lande-
dekapsel lagen etwa noch fünf stunden
vor ihnen bis bis sie als erste lande
bewohner des planeten erde stunden
den ihren fuss auf einen fremden lande-
de himmelkörper setzen sollten stunden.
Das ist ein dokumentarisches Sonett, das nicht nur die Mondlandung dokumentiert, sondern auch den Tod des Sonetts und den sprachkünstlerischen Witz dessen, der mit einigen anderen zusammen der Dichtung alten Stils ihr Hinscheiden dokumentierte.
Jörg Drews: „mia geds in da wöd zu oag zua!“. Gerhard Rühm sammelt seine Poesie aus zwanzig Jahren. In: Süddeutsche Zeitung, 12.11.1970. Wiederabgedruckt in: Jörg Drews, Luftgeister und Erdenschwere. Rezensionen zur deutschen Literatur 1967-1999. Suhrkamp, Frankfurt 1999, S. 40-44.