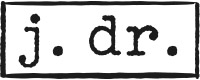Jörg Drews: Die Chose schien nur glückhaft heiter. Unfrohes Deutschland: Walter Kempowskis „Hamit. Tagebuch 1990”
1990 hätte Walter Kempowski eigentlich im Tagebuch durchgehend einen triumphierenden Ton anschlagen können. Die DDR erweist sich als genau jene Art Staat, als die er sie schon immer benannt hatte: heruntergekommen in jeder Hinsicht und in ihrer Schäbigkeit zu Recht eigentlich als „Ostzone” zu bezeichnen, und wer dies nicht geglaubt hatte, wie viele blinde oder betuliche westdeutsche Linke, dem wurde das nun beim blitzartigen Bankrott und Ausrinnen der DDR vorgeführt.
Aber Kempowskis Tagebuch aus diesem Jahr 1990 verkneift sich auf weite Strecken das Rechthaben; der Ton ist eher melancholisch, auf der Agenda steht gleich am Jahresanfang ein Besuch mit Bruder Robert in der Heimatstadt Rostock und später dann im Gefängnis Bautzen, das von 1948 bis 1956 Kempowskis Adresse in der DDR war, und sogleich muss er erkennen, dass kein Fernsehfilm diese Realitäten wird einfangen können: Authentizität der Bilder und der Erinnerung ist sehr schwer medial herzustellen, und seine Verklärung der Heimat Rostock als ein „neues Jerusalem” ist auch am Ende. Erinnerungen und Assoziationen lassen sich nicht kommandieren; weder an Gefühlen noch an Bildern steigt einem auf, was man glaubt aufsteigen lassen zu können. „Was denken Sie vor der alten Wohnung?” lässt er sich vom Fernsehen vor dem Haus Augustenstr. 90 in Rostock fragen und antwortet, sich kopfschüttelnd abwendend: „Ganz was anderes, ihr lieben Leute, ganz was anderes.” Die „Heimat” ist nicht ungebrochen benennbar, sondern nur in dem wie entstellt wirkenden, vom Dialekt gefärbten Titel: „Hamit”.
So entspannt, jokos und bisweilen kalkuliert schrill, wie Kempowski die Eintragungen im Jahr 1983 in sein Tagebuch „Sirius” hatte hüpfen lassen, kann es also 1990 nicht zugehen; die Stichworte Bautzen, Rostock, Wiedervereinigung und Wieser-Affäre – ein Journalist, der noch nie was vom künstlerischen Prinzip der Montage gehört hatte, bezichtigte Kempowski des plagiierenden Diebstahls von Textstücken – machen das Jahr nicht heiterer; nur im Traum durfte Kempowski erleben, dass der Journalist ihn später um Verzeihung bat für seine Anschuldigungen – hätte er es doch in Wirklichkeit getan!
Doch Kempowskis launige Frechheiten, seine Kunst der giftigen Kennzeichnung allerhand politischer und künstlerischer „Persönlichkeiten” von Eugen Gerstenmaier über Klaus von Dohnanyi, Günter Gaus und Freimut Duve bis hin zu Max von der Grün hat ihn nicht verlassen. Aufgeblasenheiten aller Art kommen ihm gerade recht, um hineinzustechen. Die Wende 1989/90 war ja auch wirklich ein Zeitraum, wo Leute haarsträubend schnell ihre Meinung wechselten und den Ereignissen auf erheiternde Weise hinterherrannten, wetterwendisch und beflissen; da gabes weiß Gott was aufzuspießen.
Bis zu einem gewissen Grad, in seiner Atemlosigkeit nämlich, handelt dieses Tagebuch davon, dass damals große unerwartete Ereignisse so aberwitzig rasch einander folgten, dass wir noch nicht einmal Zeit hatten, verblüfft zu sein, und jetzt, 16 Jahre später, vor allem darüber verblüfft sind, dass wir nicht noch viel verblüffter waren – fast könnte man sagen: dass wir (nach 40 Jahren Kalten Kriegs und einer Sowjetmacht, die festgemauert in der Erden schien) nicht doch den Verstand verloren über so lapidare Meldungen wie: „Gorbatschow erlaubt deutsche Wiedervereinigung” oder „Ostdeutschland in die NATO” oder „Warschauer Pakt wird aufgelöst”. Alle irrten in ihren Einschätzungen und Erwartungen, alle waren wir nicht auf der Höhe des Moments, und rückblickend sehen wir das jetzt mit komischer Deutlichkeit, gerade auch nochmals durch Kempowskis Tagebuch.
Die Menschheit am Nebentisch
Man addiere hierzu noch Walter Kempowskis Stimmungsschwankungen, seine raschen Wechsel von drögem Räsonnement zu bösartigen Ausfällen (augenzwinkernd oder nicht), von Paranoia zu Selbstsicherheit und zurück, von Selbstmitleid zu zerknirschter Selbstkritik, seine Rollenwechsel vom Satiriker zum Clown, dann sieht man, nach welcher Dynamik das Ganze funktioniert: Die Mischung macht’s, und man wird geradezu süchtig nach dieser Sorte von Unterhaltsamkeit, die mal in Wortkargheit und geheimnisvollen Andeutungen, mal wieder in inspirierten Geschwätzigkeiten forttänzelt und an Banalitäten das Weltwesen erkennt.
Wenn etwa Kempowski in einem Restaurant drei Seiten lang nur mitschreibt, was am Nebentisch an Ansichten und Aussprüchen fällt, dann hebt es einem den Magen und man wünscht die Menschheit zum Teufel. Das ist natürlich politisch unverantwortlich, und als sittlich gefestigte Persönlichkeit lassen wir uns das nicht durchgehen – müssen aber doch. Denn der Zwang, immer politically correct zu denken und zu reden, gebiert den Drang – seien wir doch ehrlich, sagt Kempowski implizit – , immer noch unkorrekter zu denken. Das macht er sich systematisch zunutze und pfeffert seine „unmöglichen” Ansichten immer wieder dazwischen. So funktioniert das, und so werden die Tagebücher nach und nach zur dritten Säule von Kempowskis Werk, nach den neun Bänden der „Deutschen Chronik” und den zehn Bänden von „Das Echolot”.
„Hamit” hat, bei aller Zersplitterung in Einzeleinträge, ein durchgehendes Thema; die Geschichte hat es ihm aufgedrängt, es heißt: Wie die Deutschen des Geschenks der Wiedervereinigung nicht recht froh wurden, und Walter Kempowski auch nicht. Die Chose schien doch so glückhaft heiter und vielversprechend loszugehen, aber gegen Ende 1990 sind die Leute schon eher depressiv, ach was: einfach miesepetrig. Die einen sagen, sie müssten zu viel zahlen, die andern klagen, es würde ihnen nicht genug gezahlt; die intensivste Ost-West-Gemeinsamkeit besteht in unfrohem Stänkern. Kempowski seinerseits merkt: Ich bin doch mehr Wessi als ich dachte, Rückkehr nach Rostock kommt jedenfalls nicht mehr in Frage.
„In Güstrow durch den sehr norddeutschen Dom gelatscht” – der Satz bildet Kempowskis Stimmung fast mimetisch ab, und da sind dann offene Hassausbrüche fast schon erfrischend. Die allerdings kommen bei Kempowski leise zitternd und wie auf Filzpantoffeln daher. Man muss ein Gespür für die Wucht der Mini-Explosionen in seinen Texten haben oder bekommen: sein Anarchismus brüllt nicht, sondern nölt kühl, auch über sich selbst, wenn er sich mal zu sentimental oder selbstmitleidig vorkommt.
Es herrscht immer noch heftiges Leben in Walter Kempowskis Tagebuch-Bude. Eigentlich müsste man dieses Buch des Chef-Collagisten und Montagisten durch eine Zitat-Collage vorstellen, denn eine solche steckt in „Hamit”. Mit anderen Worten aber: Lesen Sie es!
Walter Kempowski: Hamit. Tagebuch 1990. Albrecht Knaus Verlag, München 2006. 417 Seiten, 24,95 Euro.
Jörg Drews: Die Chose schien nur glückhaft heiter. Unfrohes Deutschland: Walter Kempowskis „Hamit. Tagebuch 1990”. In: SZ, 22.5.2006