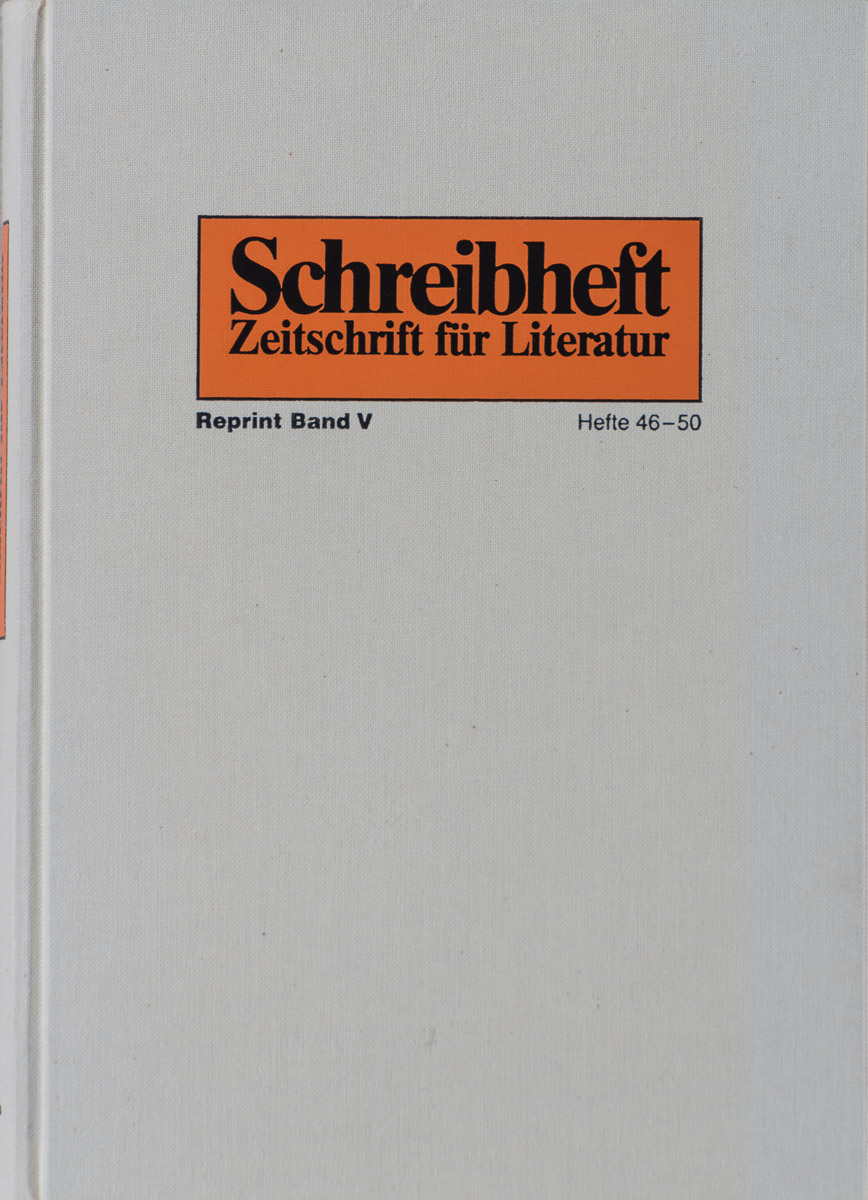Jörg Drews: Laudatio zur Verleihung des Ernst Meister-Preises
Lieber Oskar Pastior,
meine Damen und Herrn,
vor den Preis haben die Götter zuerst den Schweiß und dann den Preis gesetzt. Der Schweiß, den wir Juroren an einem sonnigen Juli-Tag vergossen haben, kann Oskar Pastior ja egal sein, der Preis aber winkt ihm nun kurz nach meinem Preis; den muß er noch über sich ergehen lassen. Wir haben uns für Oskar Pastior entschieden, weil einem bei ihm nicht, wie bei anderen Autoren, „trotz aller Schönheit der Bilder, trotz Löffel auf Löffel Poesie, der Geschmack auf der Zunge zergeht“. Uns machte vielmehr Lust, einen Dichter öffentlich geehrt und beschenkt zu sehen, der – in eine spezifische Spannung zwischen Ost und West gestellt – „heilig-öffentlich Geheimnis“ ausspricht, und dies erstens so geheimnisvoll, daß auch die von ihm Bezauberten oft ganz wirr über ihn reden: sie sagen zum Beispiel, er sei „unterwegs zum biomolekularen Zentrum“ der Sprache, „gleichsam zum Ursprungsort, zum statu nascendi“. „statu nascendi“ – der Kasus scheint es in sich zu haben! Und zweitens spricht Pastior dies Geheimnis nicht in westöstlicher Kutschenbequemlichkeit aus, wie weiland Geheimrat Goethe auf seiner Hedjra an den Main, sondern er hat größte Unbequemlichkeiten auf sich genommen, um in dem in mancher Beziehung ja nun wirklich freieren Westen die reine Luft der Poesie kosten zu dürfen, und um sie für uns zu bereichern. Sicher haben es bis heute junge Autoren nicht ganz leicht, aber Oskar Pastior ist für seine Literatur in einem ganz besonderen Maße eingestanden: er hat es auf sich genommen, mit 40 Jahren noch einmal das Land zu wechseln, da in Rumänien der Staat wie auch seine Landsmannschaft Erwartungen an ihn hatten, die er nicht erfüllen, denen er sich nicht bequemen wollte. Er kam in den Westen zu einem Zeitpunkt, da noch nicht jeder aus dem Osten flüchtige Poet der Aufmerksamkeit von Medien, Verlagen und Stipendiengebern sicher sein konnte – das Risiko des Scheiterns, sagt er, war einkalkuliert.
Verglichen mit der Verbreitung dessen, was sich auch Literatur nennt und in aller Munde ist, bleibt unsere Begeisterung für Oskar Pastiors Literatur natürlich ein „Randgruppengeplänkel“. Aber der Fall ist nicht hoffnungslos; es gibt doch seit 1969, seit dem Erscheinen seines ersten Buches Vom Sichersten ins Tausendste, eine stetige Zunahme von Leuten, die was merkten, die seine Literatur liebten und kauften. Wir wollen ihn also preisen auch für die leise Beharrlichkeit, mit der er arbeitete und durchhielt, eine Beharrlichkeit, mit der er auch Verlage wie Suhrkamp und Luchterhand beschämte; bei denen nämlich erschienen seine ersten beiden Bücher, die könnten sich noch heute mit ihm schmücken, sie hatten aber keinen langen Atem.
Auf seine ganz zurückgenommene Weise schrieb er Bücher, die einen immer wieder überraschten durch einen Neuansatz an einer Stelle, die man nicht vermutet hätte. Inzwischen gibt es ja schon Autoren, die etwas Ähnliches machen bzw. gemacht haben wie Pastior es etwa in seinen 33 Texten nach Sonetten Petrarcas tat: nämlich sich auf vorhandene Texte oder Vokabularien zu beziehen und diese ganz indirekt, um mehrere Ecken herum zu ,übersetzen‘ – etwas ganz anderes an ihnen zu übersetzen als die 1:1 – Übersetzungen tun und tun müssen –, um zu sehen, ob damit Sprechweisen in deutscher Sprache zu konstitutieren sind, die bisher unerhört waren. Und auf eine ganz unspektakuläre Weise sind die Texte Pastiors viel radikaler, einfallsreicher, beweglicher, auch sprachlich einfach intelligenter als andere, die sich von einem ähnlichen Punkt abstoßen, sich aber viel schicker und krakeelender gerieren.
Er selbst kann übrigens sehr gut Götter neben und über sich haben; H.C. Artmann installiert er sogar als Papst in einem Text, der sich zur Fußwaschung dieses Fürsten bereiterklärt; James Joyce, Ernst Jandl oder Arno Schmidt muß man wohl zu den Ahnen oder Brüdern Pastiors zählen, und weitab, aber doch ganz ernsthaft in Verbindung zu bringen mit der Literatur Pastiors stehen da Sigmund Freud und Jacques Lacan. Der eine der beiden hat sich zwar nie darüber geäußert, in welchem Verhältnis zur Sprache denn nun grundsätzlich das Unbewußte stehe, aber er wußte, welche sprachlichen Phänomene dies Unbewußte sich listig, witzig und albern zunutze macht, um zum Vorschein zu kommen, und wenn Rhebus und Vexierbild zwei Metaphern zur Charakterisierung des Traums sind, dann eben nicht zufällig auch zur Beschreibung des Funktionierens mancher Texte Oskar Pastiors. Der andere, Jacques Lacan, den man nicht ganz identisch setzen sollte mit Scharlatan, ist sich der sprachlichen Verfaßtheit des Unbewußten ganz sicher gewesen – was Oskar Pastior als Theorie vielleicht gar nicht so interessiert, was aber beim Leser doch zur Schärfung der Aufmerksamkeit auf die Struktur der Pastiorschen Texte beiträgt: Die Bedeutung eines Textes liegt ja eher in der Dynamik des Verhältnisses seiner Elemente zueinander als etwa allein in der fixen Semantik oder starren Symbolik dieser Elemente. Ob eine Literatur solche Einsichten gerafft hat – mit oder ohne bewußte theoretische Verbindung etwa zur Psychoanalyse, ist gleichgültig –, entscheidet wohl heute mit über ihren Rang. Glaube nun allerdings keiner, daß Pastiors Texte also als Schrift des Unbewußten zu lesen wären; Traumhaftigkeit und Unschuld sind Anmutungen, die von diesen Texten nur ausgehen können, weil Pastior ganz bewußt die Sprache zu etwas verhält: von selbst tut die ja nichts, und ihre Zauberkraft wie ihre Entbundenheit von Zwängen bekommt sie erst wieder durch die Manipulation hindurch, nach der Manipulation.
Witze, wenn sie funktionieren sollen, müssen komplexe und unerwartete Zusammenhänge mit sprachlicher Ökonomie und auf mehreren Ebenen zugleich ansprechen; sie müssen uns blitzschnell überrumpeln. Daher kommt nicht zuletzt das Lächeln auf den Gesichtern von Pastiors Zuhörern: er schafft lauter zärtliche Überrumpelungen, präsentiert allerdings manchmal auch – und das ist genauso erheiternd – willkürliche Verknüpfungen, etwa über Klangähnlichkeiten von Wörtern, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, oder doch fast nichts: Da gleitet etwa ein Text von „Fundsachen“ über „Pfandsuchen“ zu „Pfannkuchen“, und erst nach und nach kommt man drauf, daß das Qartum comparationis da etwa ,des Glückes Unterpfand‘ sein könnte, daß da süße Pfänderspiele in der Texttiefe ablaufen, bei denen es um Küsse geht, um Baisers aus einer Art „Schlagsahne“, mit der man sich füllen kann, bis man „Schlagseite“ hat… usw. Derart können die Wörter als Worte nebeneinander stehen; manchmal aber teleskopiert er sie ineinander, macht sie zu Kreuzungsstellen, schürzt sie zu Knoten aus mehreren Fäden; sie sind – Sigmund Freud leiht uns (obwohl er doch schon für die Faxen der Dadaisten und Surrealisten, die sich auf ihn beriefen, nur Spott übrig hatte) den passenden Terminus – ,überdeterminiert‘, etwa jenes „Höricht“, ein von Pastior erfundenes Wort, eine durch ihn erst konstituierte Gattung, in der das Hören und die Frage ,hör ich richtig‘, auch das Gerücht, der Rettich samt dem Kehricht unter Aufbietung relativ weniger Buchstaben anwesend sind: Klangähnlichkeit stiftet Metaphern, Metaphern sind froh, daß sie sich nicht umständlich zu entfalten brauchen, sondern sich in einem Klangklumpen verstecken können. Was ist denn nun gemeint? Alles ist gemeint, und zwar so schwebend und präzise zugleich, wie bei „Vorderlamm und Ludenwurg“, bei „Hindernis und Ebendrung“ Hindenburg und Ludendorff ebenso sicher anwesend sind wie sie auf dem Blatt überhaupt nicht dastehen.
Und so reimt sich keineswegs zufällig auf „Höricht“ auch „töricht“ – wer jetzt sagt, daß man so natürlich leicht vom Hölzchen aufs Stöckchen komme und wo da noch ein Halten sei, wenn ein bestimmtes Wort aus Pastiors Band Fleischeslust sowohl die Verdeutschung eines Terminus der Theologie (Abteilung Pneumatologie), einen derben Ausdruck aus der Sexualsphäre und das alte Wort für „Blüte“ anspiele oder enthalte, dann ist zu antworten, daß Pastior sich alle diese Möglichkeiten eröffnet, die Poetik oder Methodik seiner Texte aber darin besteht, sie und sich konstruktiv zu begrenzen, zu beschränken, vom Tausendsten wieder ins Sicherste zurückzufinden.
Folgen wir noch einmal dem Witzig-Losgelassenen eines Pastior-Textes, der Überführung des Bekannten ins lachhaft Neue durch winzige Operationen an ein paar Vokalen oder durch Neu-Kombination von Wortbestandteilen: da wird etwa aus dem bekannten „listenreichen Odysseus“ die „listenreiche O-Diseuse“ (wobei man noch überlegen kann, ob man das dann nicht „Originalton-Diseuse“ lesen muß, denn es handelt sich ja um ein Wort aus einem „Höricht“); da läßt man das Wort „Rondom-Dior“ klingen, lauscht ihm nach und entdeckt „Rund um die Uhr“ darin, nur sozusagen pariserisch veredelt, den Leser leise düpierend, und schließlich kann man das neue Wort „Kriegstaube“ so lange anstarren und mit Assoziationen bombardieren, bis es sein Geheimnis hergibt: seine Herkunft aus „Friedenstaube“ und „Kriegsblinde“, wobei die Kriegsblinden nun wieder einen Hörspielpreis vergeben. Das hat, zugegeben, auch ein Ingrediens von Albernheit, von subtiler, spitzbübischer Kalauerei, aber da steht Pastior ja nicht allein. Wenn in Joyces Finnegans Wake in einem Wort mit gutem Grund sowohl die deutschen „Heckenbeeren“ wie auch der amerikanische „Huckleberry“ zu vermuten sind, dann ist das ja neben der Ingeniosität auch ein bißchen albern. Aber erstens trägt einen der Strom der Sprache, die Flut des Klanges dann doch durch das unerhörte Ganze, durch die alles bewispernde, alles anrührende Mehrstimmigkeit etwa von Finnegans Wake hindurch, und zweitens wäre zu fragen, warum denn in der Literatur des 20. Jahrhunderts – oder eigentlich schon in Teilen der Literatur des 19. Jahrhunderts, etwa bei Lewis Carroll – zum Kalauer tendierende, Wortspiele, kleine faule Sprachwitze, ,puns‘ einerseits an die Stelle dessen getreten sind, was man sonst so „Witz“ und „Esprit“ und „Humor“ nannte, und andererseits ein vielfach genutztes Verknüpfungs- und Textstrukturierungsprinzip geworden sind. Ist der Kalauer der Witz des Plastikzeitalters, die Gestalt des Esprit in einem Wertevakuum? Stiften Wortspiele da Verbindungen, wo metaphysisch substantiierte Zusammenhänge nicht mehr zu stiften sind? Hängt damit übrigens auch zusammen, daß es bei Oskar Pastior zwar auch großen, ruhigen Ernst in seinen Texten gibt, daß Pastior aber, wenn auch nicht so heulend-doloros verhunzt wie bei Ernst Jandl, ohne viel Aufhebens zurückgenommen und höchstens noch angespielt wird? Beleg dafür könnte jener Satz sein, in dem Oskar Pastior dem Namenspatron des heute zu übergebenden Preises seine Reverenz erweist. Sage vom Ganzen den Satz ist der Titel von Ernst Meisters Gedichtband von 1972. Das ist auch schon ein fordernder, nicht mehr unbedingt durch Zuversicht des Gelingens gedeckter Satz; bei Pastior aber heißt es noch skeptischer, noch zurückgenommener: „Lernst du, neben dem Koffer zu schlafen? Als Decke – den Zipfel vom Ganzen, den Satz?“
Wenn Pastior im Nachwort zu seinen „Anagrammgedichten“, Gedichten also aus Anagrammen der Titelzeilen von Erzählungen Johann Peter Hebels schreibt: „Die Zeile als Willkür und Maß“, wenn er über die Erarbeitung der Anagramm-Zeilen sagt: „… Eine Menge Tüftelei also, der Autor konnte fast verschwinden –“, wenn er sich die Pflicht des Sonetts in den „Sonetburgern“, das Schema des Dreizeilers bei dem Band Wechselbalg auferlegt, dann könnte man meinen, hier sei eher ein Bosseler, Bastler, Methodiker am Werk, der sich selbst, Biographisches, Erfahrenes, Meinungen ganz aus seiner Literatur heraushält. Nun hat sicher Pastiors Literatur etwas mit seiner überaus großen Diskretion in persönlichen Dingen zu tun, aber es prägt ja seine Texte nicht Erfahrungsarmut, sondern Erfahrungen werden bei ihm nur nicht so spektakulär verwortet und wiedererkennbar vermarktet. Wäre nicht Emotion und Erfahrung in seinen Texten sedimentiert, wir würden uns nach kurzer Zeit abwenden. Im übrigen waren ja auch die Autoren der Vergangenheit schon viel mehr Methodiker und wenn man so will ,Formalisten‘ als wir meist denken, rührten auch nicht nur inhaltistisch in Stoffen, Meinungen und Weltanschauungen, nicht nur Mallarmé, der im Caféhaus saß und sagte, er suche ein zweisilbiges, auf der ersten Silbe betontes, vokalisch helles Wort, das ungefähr synonym mit „Lattenzaun“ sein müsse, sondern auch Schiller, der an Goethe schreibt: Manchmal weiß ich schon, wie eine Zeile lauten soll, wie sie klingen, wie ihre Kadenz sein soll, und dann suche ich lange nach den Wörtern dafür, weiß also noch gar nicht, was drinstehen wird.
Oskar Pastior der Textbaumeister und Kalkulator also auf der einen Seite: Fama und Realität. Aber andererseits dann Oskar Pastior der – so steht’s die kreuz die quer in vielen Rezensionen – „Spielmacher“, „Phantast“, „Zauberer“, „Magier“, der – Achtung, weitere Steigerung!: – „Sprachmystiker“. Daran ist soviel richtig, daß unsere Aufmerksamkeit sich bei ihm meist an der sinnlichen und methodisch-reflektiven Dominanz des Sprachlichen festmacht und daß es hier nicht nochmal zu erleben gibt, was der Dichter erlebt hat: zu erleben gibt es da weitgehend nur, was Pastior zum ersten und einzigen Mal in seinem Text jeweils passieren macht. Man behält hier durchaus immer das Gefühl: Das ist etwas anderes und der ist jemand anderes als ich selbst; ein unreines Verfließenlassen der eigenen Gefühle in die des Autors ist weder statthaft noch möglich. Der Gebilde-, der Gegenstands-Charakter seiner Texte ist eindeutiger als sonst bei Gedichten; es sind Gegenstände aus Sprache sui generis, sie verhalten sich nicht mimetisch zum Draußen, zu Story und Szene, noch nicht einmal eindeutig zu Thema u.ä. „Mystisch“ an ihnen ist – wenn denn das Wort wirklich sein muß –, daß sie Versenkung in ihre Einmaligkeit fordern, im Idealfall rückhaltloses Sich-Einlassen auf die Disziplin ihres Gemachtseins, und daß sie erst dann sowas wie Erfahrung freigeben. Seine Texte sind aus künstlicher Geheimsprache hergestellte Mysterien – und die mögen dann vielleicht doch in einem uns vielleicht allen verborgenen Sinn Analoga eines noch nicht ergründeten Weltgeheimnisses sein – sie suggerieren es jedenfalls so lieblich, daß man’s fast glauben möchte. Man hat bei ihrem Hören und Lesen weder vorher noch hinterher sogleich einen Begriff, unter dem sie subsumierbar sind. Und indem ich so spekuliere, bestärkt mich eine „Stimme im Badhaus“, die sagt zum Poeten und zu mir zugleich: „Da ist schon was dran, sagst du, und entledigst dich eines weiteren Oberbegriffs.“ Alexander Kluge probiert so zu denken und Prosa zu schreiben, Oskar Pastior versucht so zu dichten.
Und deshalb muß man, nach Inhalt oder Thema eines Gedichts von Pastior gefragt oder sich fragend sagen: Was das folgende Gedicht etwa im Innersten zusammenhält, ist die Frage nach den Variations- und Entfaltungsmöglichkeiten der Silbe „… elch…“ und einiger ihrer Verwandten:
– oder die Elche. Welche? Die wie Häcksel im Stroh-
sack? Die Fenchelgeräderten? Die auf dem Wechsel?
Schönes Getier, stolzes Getier. Ist stolz schön? Ist
Getier stolz? Ist Getier auf seinem Platz? Von El-
chen, sagt Cäsar, sie wechseln wie Streusalz die Rich-
tung, die auf der Pfütze, die unterm Licht – das wie-
derum wechselt die Elche, grün, weiß, grau, wie eine
Flechte. Sprechen wir nicht davon…
Es geht aber noch so weiter wie es dann auch endet: „beschämend schön“. Und wie eine Suppe ja nicht durch ihre Ingredienzen definiert ist, sondern durch ihre Suppigkeit und Löffelbarkeit, so ist Thema und Substanz etwa von Pastiors Gedicht „Oh, Magdalena!“ so etwas wie Hälftigkeit, Zweigeteiltheit, Gespaltenheit, hohle Hemisphärität, innere Leere wegen ausgehender Puste, der Vergleichspunkt zwischen Merseburg und Magdeburg sowie das Phänomen des rechten und linken Hauptstadtteils. Falls Sie mir das nicht glauben oder für allzu abstrakt halten: ich werde das Gedicht gleich ganz zitieren, nämlich dann, wenn ich zuerst grundsätzlich und zweitens zu Ihrer Verführung auf eine bestimmte Ebene dieses Gedichts gesagt habe, daß Oskar Pastior in vielfachem Sinne ein großer erotischer Dichter ist. In einem seiner Bücher hat er die Vokabularien der Erotik, der Kulinarik und der Literatur so ineinandergeschoben, so übereinandergebracht, daß sich nicht nur das, was Roland Barthes „Die Lust am Text“ genannt hat, ganz beispielhaft ergibt, sondern im Detail sich die saftigste Unzucht einstellt, das Verschlingen von Büchern, das Eindringen in die Literatur und das Lesen im Buch der Natur gänzlich ununterscheidbar werden. Aber nicht nur in dem Band Fleischeslust,wo’s der Titel ja schon verrät, ist er an der Schaffung und Einverleibung von Text-Körpern aufs zärtlichste interessiert, sondern auch in einem solchen Gedicht wie
Kratze mich in Oberhemden
unter beiden Abfallbeinen
etwas tiefer bitte zwischen
meinen beiden Oberen Hemden
Unter beiden Hemden sollst
du mir von oben durch meine
etwas unterhalb des Latzes
beiden zwei von unten bitte
Zwei der zwei Hemden kratzen
an den Unterseiten zwischen
beiden abfallenden Schultern
meiner zwei unteren Hemden
Bitte kratze mich zwischen
allen meinen beiden Hemden
höher bitte sollst du unter-
halb der Beine mir abfallen
Und nun also das versprochene Gedicht über Hälftigkeit und Zweigeteiltheit, „Oh, Magdalena!“ –:
Die Stadt, in der mein Denkvermögen sich ver-
plempert, ist eine große, stolze, runde Stadt.
An Pferde denken ist nicht drin, zum Beispiel.
Sie, die mein Ein und Alles ist und aus zwei Mer-
seburger Hälften besteht, heißt ja auch Merse-
burg, weil, selbst wenn ich an Pferde denke, was
nicht drin ist, etwa, mein Ein und Alles sich
in ihr verringert: und besteht aus zwei großen,
stolzen Halbkugeln, weil diese auseinanderfallen,
wenn meinen Pferden die Puste ausgeht. Dort vor
den Toren meiner Stadt, die von Beschwörungs-
formeln zusammengehalten wird, rackern die Pfer-
de sich ab. Sie verbrauchen viel Puste. Wenn Mer-
seburg vor beiden Toren Merseburgs entzweigeht,
ist es entweder Tag, oder es ist Nacht. Ich brau-
che sowohl den Tag als auch die Nacht zum Denken –
davon geht mir die Puste aus. Meine Stadt, in der
die Puste ausgeht, hält nicht nur die Physik son-
dern auch die Pferde, an die zu denken nicht drin
ist, zusammen – sie reißen und reißen, dann den-
ke ich, mein Denkvermögen geht mir aus. Wenn die
stolzen Hemisphären auseinanderfallen, geht, den-
ke ich, auch den stolzen Sprüchen die Kraft aus
und Ein und Alles entweicht – nach Nordnordsüd
Natürlich braucht man nur vielleicht noch auf die Teilung Berlins hin die Andeutungen zu konkretisieren und an gelehrtem Wissen beistellen, daß es zwei Merseburger Zaubersprüche gibt, dann ist alles klar, außer vielleicht das Wort „Nordnordsüd“ am Ende. Oder wendet jemand ein, „Magdalena“ seien doch schließlich nicht zwei, sondern ein Individuum? Dann sage ich, daß deren Liebreiz doch auch teilbar ist: in Magda und Lena. Nun aber, da wir wissen, worauf man bei Pastior manchmal auch hören kann und muß, würden Sie bei der Verlesung des allerersten Textes aus dem Band Fleischeslust sagen, daß man den doch nicht öffentlich rezitieren sollte. Ich tu’s ja auch gar nicht.
Neulich schrieb jemand – gar nicht tadelnd übrigens –, Oskar Pastior verweigere sich der ,Mitteilungsfunktion‘ von Sprache, um ihr anderes, Reineres, Poetischeres abgewinnen zu können. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz stimmt. Der Eindruck entsteht doch vielleicht zum Teil nur, weil wir auch von Gedichten eine ganz andere Art von Mitteilung erwarten, als sie dann etwa Pastiors Texte bieten: und dann sagen wir, die hätten keine Mitteilungsfunktion mehr. Es ist ja schon recht & richtig, die Sprache ist ein Kommunikationsmittel, aber sie kommuniziert oft was anderes und viel indirekter als das, was der Sprechende überhaupt ahnen kann, geschweige denn ,eigentlich‘ kommunizieren will. Sagt man: die Sprache ist eigentlich ein Kommunikationsmittel, muß man gleich dazusagen: Ja, aber Poesie spricht bekanntlich ,uneigentlich‘, und daher der ganze Spaß und die Verwirrung. In Rumänien sagte vor vielen Jahren ein Rundfunksprecher: „Weitere Nachrichten aus dem Ausland“, und eine Zuhörerin verstand ganz begeistert: „Alte stille Sterne“. Die linguistischen Details sind zu kompliziert, als daß ich sie hier ausbreiten könnte, aber erstens einmal hat mir vor einigen Jahren die Erzählung dieser Geschichte kommuniziert, daß Pastior in Rumänien Rundfunkreporter und Redakteur war, was ich vorher nicht wußte; zweitens rief das sprachliche Mißverständnis des alten Weibleins in der rumänischen Provinz die blanke Poesie hervor, und drittens nützt Pastior still, heiter und gründlich, in viele Richtungen sich vorwagend, all dies ,Uneigentliche‘ an der Sprache aus und macht Poesie draus. Sicher, mancher macht methodisch deutlicher, handhabt auch sturer, wie man mit Permutationen etwa den Satz „Stille Freude wärmt findigen Griff“ so um und um wenden kann, bis in freudiger Stille ein griffiger Fund den Finder wie auch den Zuhörer wärmt. Ich spreche natürlich von Pastiors Freund Ludwig Harig, der sich ordentlich und zuversichtlich am Geländer der Permutation vorwärtsbewegt und dann am Ende mit seiner ganzen sprachlichen Ordentlichkeit und sozialverpflichteten Mitteilbarkeit sein ganzes Sprachlehrbuch „Sprechstunden für die deutsch-französische Verständigung“ in fröhlicher Anarchie und bei einem Wort enden läßt, das mit dem Pastiorschen „tinnitus“, dem Rauschen im Ohr fast bedeutungsgleich ist:
… ich bin Pierre Dupont. Sie haben mich mit dem Mechaniker Henri Dupont verwechselt, diese Verwechslung geschieht leicht Sie geschieht auch oft, und nun höre ich nichts mehr als ein verworrenes Rauschen.
Oskar Pastior begab sich seit zwanzig Jahren schon ohne Absicherung auf die offene See, in dieses Rauschen hinaus, und gegen dieses Rauschen spricht er an wie Demosthenes am Meer bei Athen.
Weil ich glaube, daß Onkel Toby in Sternes Tristram Shandy recht hat mit seiner Überzeugung, „there is something in names“, „Namen haben’s irgendwie in sich“ oder auch „Mit Namen hat’s irgendwas auf sich“, sinniere ich auch immer an dem Namen Oskar Pastior herum. Beim gegenwärtigen Stand meines Spekulierens (und das heißt bei Pastior natürlich auch: bei meiner Kalauerei mit Erkenntnisabsicht) scheint mir Pastior der Komparativ von Pastor: noch hirtiger als der einfache Hirte schart er seine Schäfchen, uns, seine Gemeinde um sich und gewinnt dem Glauben an die Heilige Poesie immer neue Anhänger. Unpassenderweise, dachte ich zuerst, fiel mir zu Oskar immer nur „frech wie Oskar“ ein. Aber das ist doch richtig. Denn erstens setzt er dem Hörer mit seinen Texten ja doch einen Floh ins Ohr; wie man nach der Arno-Schmidt-Lektüre etymt, ganz Etym-verseucht ist, so denkt man nicht nur bei allen möglichen Texten des Alltags dieser Welt: hoppla, dieses Wort ist ein Oskar-Wort, könnte zu seinem Vokabular gehören, sondern viele seiner eigenen Wörter und Wendungen, von ihm geprägt oder von ihm neu beleuchtet, sind in unsere – jedenfalls in meine – Sprache übergegangen. Höre ich von bestimmten Plänen des Postministers oder kommt eine Telefonverbindung nicht zustande, kann ich nach Pastior-Lektüre nur noch denken: „Adafactas Cowlbl“; er hat Tacitus und Tinnitus, Schweigsamkeit und Ohrensausen zu Geschwistern gemacht, und zur stimmlichen Einübung des Diphthongs oi/eu wünscht man sich endlich nicht mehr eine bescheuerte Vertonung des Satzes „Beut Euch heut des Teufels Zeug“, sondern eine freudige Gesangsstundenweise auf Pastiors Höricht:
FREUT EUCH, LEUTE, FREUNDLICHE LAUTGRUPPEN SIND EINmarschiert, sie haben die Rundgebäude besetzt, alle Druckereimaschinen läuten, alle Redakteure haben neue Schleifen, auch neue Eulen-Säulen sind im Anrollen: Heute ist Feiertag. Euer Feuerlöscher schäumt Poesie, ei wie fein deutsch wir schreiben, Anlaut, Umlaut, Ablaut. Freut euch, geläuterte Benediktbeurer, die hoyle Welt mult.
Die Welt mit heilem Menschenverstand mault natürlich manchmal über das, was zunächst wie die Schwierigkeit von Pastiors Poesie aussieht. Da nützt die Versicherung des Gegenteils, etwa gar durch Kritiker, oft gar nichts; es fruchtet auch nichts der Hinweis, man mache sich anheischig zu zeigen, daß allseits verständliche Gedichte wie zum Beispiel Goethes „Im Herbst 1775“ nur scheinbar klarer, bei genauem Hinsehen aber auch ziemlich rätselhaft und bodenlos seien. Es fruchtet aber glücklicherweise oft am meisten, wenn man Oskar Pastior selbst seine Gedichte vortragen hört. Vor Jahren waren beim Literatursymposion des Steierischen Herbstes in Graz auch Lesungen vor Hörern aus Fabriken, speziell eine vor Arbeitern des Eltron-Werkes bei Graz angesetzt. Drei Autoren lasen; zwei stellten sich auf die Zuhörer, sozial gesinnt wie man ist, ein, lasen nicht allzu Kompliziertes, das inhaltlich auch ein bißchen was mit der Arbeitswelt zu tun hatte. Und Oskar Pastior las halt – was blieb ihm übrig – seine Sachen: Kompromisse waren da nicht zu machen, solche Texte gibt es ja bei ihm gar nicht. Der Star des Abends war aber einfach Oskar Pastior. „Magie“ hin oder her, Pastior übte halt doch Magie aus; er täuschte die Erwartungen herkömmlichen Verstehens und verführte die Hörer – die wußten gar nicht wie ihnen geschah – ganz woanders hin. Sie spürten höchstens, daß da einer nicht noch woanders hin schielte, sondern seine Sache tat, nämlich „suspendieren“, Gewohntes außer Kraft setzen und Spannung erzeugen. Die Spannung kommt oft daher, daß Pastior magische Qualitäten der Sprache wieder in ihre Rechte einsetzt, solche Qualitäten wieder hervorzubringen versteht – und hier meine ich „magisch“ nicht im vagen Sinn von reizvoll, sondern als terminus für die Qualität von Sprache, die in den letzten 150 Jahren zunehmend verloren ging und um deren Restitution, besser: Neu-Synthetisierung sich auch schon Hugo Ball und Gertrude Stein, Otto Nebel und Philippe Soupault bemühten; und die Spannung kommt auch davon, daß das, was Pastior uns vorsetzt, so irritierend changiert; er präsentiert „Wechselbälger“, nicht nur in dem gleichnamigen Band: Texte, bei denen so hinreißend schwer zu entscheiden ist, was sie ,eigentlich‘, ,echt‘ sind. Weil er das aber so scheinbar leichthin und zugleich mit dichtem Listenreichtum macht, steht man oft ganz verlegen vor ihm, da man – zumindest zunächst – oft nur mit einsilbig-tumber Freude auf seine Sachen reagieren kann, wo man doch Genaueres sagen müßte. Da kann man dann nur in sich hineinzitieren:
Enge des Denkens, o kränkende Beschränkung! O wesensgegebene Keks-Menge! Verzehrende Zwänge, fernere Dränge, o transzendente Klemme!
Oskar Pastior schreibt eine Literatur, die sich nicht spreizt, nicht prunkt, sich nicht mit patziger Selbstverständlichkeit für wichtig hält. Seine Literatur ist nicht die eines Großschriftstellers, wie sie ja auch heute noch herumlaufen. Deleuze und Guattari haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Kafka. Pour une littérature mineure. In diesem Sinne sind wir für eine Literatur, die nicht groß angibt, für eine „kleine“ Literatur, für die Literatur Oskar Pastiors zum Beispiel. Aber für uns ist das natürlich große Literatur – ,große‘ kleingeschrieben.
Jörg Drews: Kleine Rede auf Oskar Pastior. Laudatio zur Verleihung des Ernst Meister-Preises. In: Schreibheft, Heft 28, November 1986, S. 199–204.