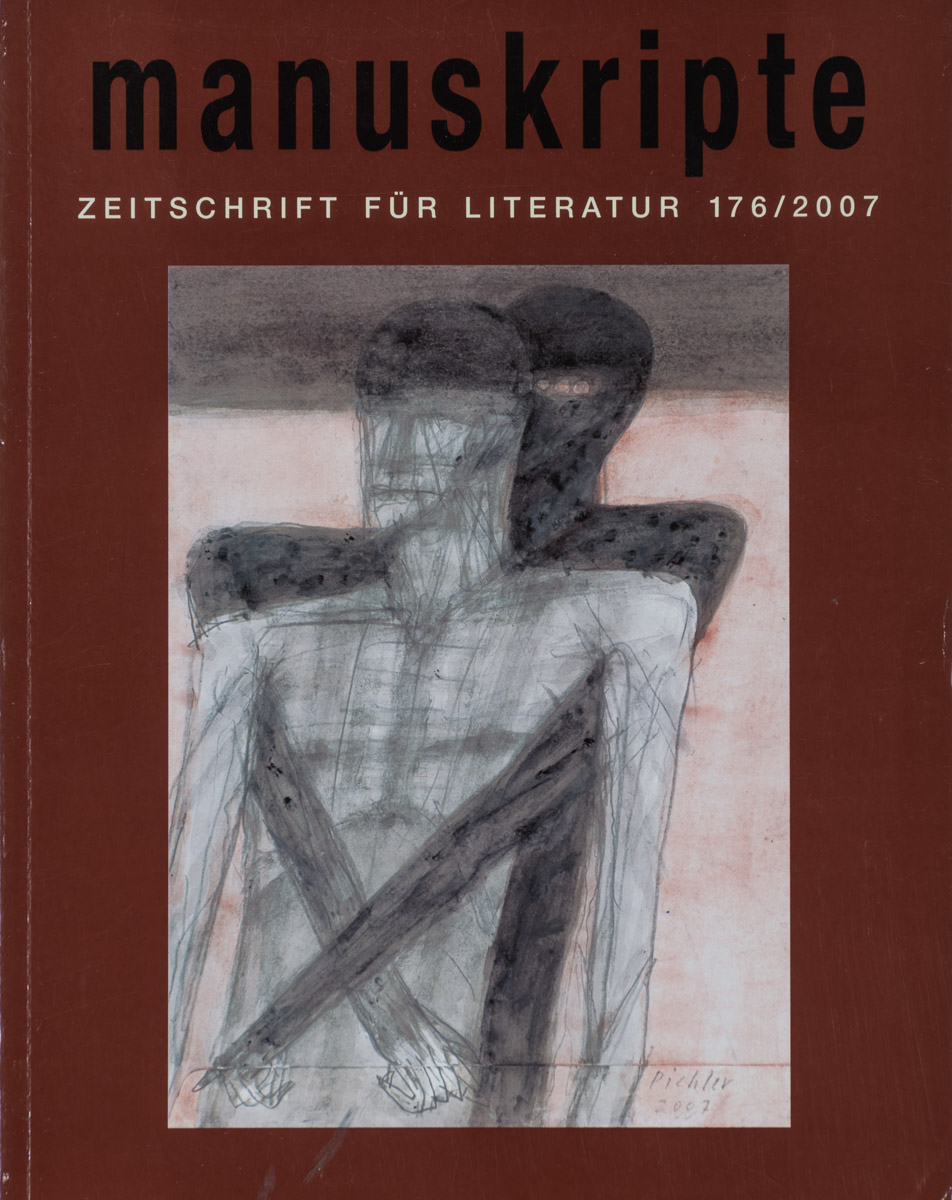Jörg Drews: Laudatio auf Michael Donhauser. Ernst-Jandl-Preis 2005
Dichten – sagt Gottfried Benn in einem seiner späten Briefe – Dichten sei ein unbarmherziges Geschäft; und es handle sich nicht so sehr darum – dies als Diagnose und als Ratschlag für Lyriker –, in Gefühlen zu schwelgen und den Leuten die beliebten Sentimentalitäten zu liefern, sondern „Faustschläge“ auszuteilen. Nun klingt das durchaus nach Gottfried Benn, dem Benn des Expressionismus wie auch dem Benn, der in dem Gedicht „General“ ein unübertrefflich böses Porträt deutscher, Hitler stramm gehorchender Generalität entwarf, die er ja als Wehrmachtsarzt kannte, aber vor allem wehrt Benn hier, ähnlich wie der Brecht der zwanziger Jahre, das Harmlose, das Feinsinnige, das Unbewaffnete ab, das sich halt mit der „Lyrik“ – das Wort mit einem spitzmundigen „üü“ gesprochen – verbindet, verbinden kann, immer wieder zu verbinden droht, und wir kennen ja alle die (sozusagen) Aufrüstungsmanöver, die Dichter immer wieder unternommen haben, um ihren Gedichten diese verdammte Harmlosigkeit zu nehmen: Man spricht aggressiv oder obszön, nimmt sich politische Themen, nimmt sich aktuelle Inhalte, reiht sich ein in irgendeine Aktions- und Einheitsfront – und kommt damit nicht herum um die Tatsache, daß auch heute sich niemand wirklich von Gedichten bedroht fühlt und die Drohung mit deren „Faustschlägen“ inzwischen fast komplett ins Leere geht; höchstens ärgern oder ein bißchen befremden kann man die Leute.
Diskutieren wir also die Gefahren, von denen das Dichten auch heute noch umstellt ist, nicht auf der Ebene des Vorwurfs der Belanglosigkeit, welcher die Gesellschaft von Banausen fast schon immer die Lyrik zieh, sondern benennen wir ernsthaft, was da harmloserweise, nicht tödlich, aber eben doch riskant und schmerzhaft, wenn man geistig-ästhetischen Dingen Gewicht beimißt – zur Lage gehört, Fragen, auf die immer aufs Neue die Dichter eine Antwort finden müssen. Es sind Fragen, nicht Deklarationen des Typs: ,Dies geht heute nicht mehr‘, kleine Lagebestimmungen, Wie etwa: Wie findet oder erfindet sich jedes Gedicht selbst eine Form, einen Verlauf, seine spezifische Kadenz, seinen inneren Halt, wenn die traditionellen Formen, auch Gattungen immer weniger fraglos gegeben sind? Wie erfindet man sich einen ,inneren Halt‘, wie organisiert man einen Textverlauf? Von welchen Zellen, welchen Parametern aus baut man ein Gedicht auf? Was passiert, wenn man ,alte‘ oder gar antike Formen, die ja immer noch bereitliegen, aufgreift – rächt sich eventuell das Vertrauen, das man ihnen entgegen bringt? Was kann man mit dem Reim noch anfangen? Allgemeiner formuliert: Woraus holen die Autoren sich die Bilder, das Vokabular, die Fügungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die Erfahrungen – wie (re)generiert sich das lyrische Sprechen? Und woran reflektieren wir überhaupt unsere Existenz, woran reflektieren die Dichter, was sie an Existenz und Erfahrung zur Sprache bringen? An der Religion unmittelbar gewiß nicht mehr, an einer Naturerfahrung, auch Erfahrung unserer selbst als Natur, auch nicht vorbehaltlos; gewiß nicht an Politischem in engeren Sinn, und wie weit trägt und welche Welthaltigkeit erzeugt ein lyrisches Sprechen, das sich an Sprache und Sprechen entzündet und reflektiert? Und der Mythos, die antiken Mythen, die ja geheiligt sind als Bildungsgut (aber eben nicht nur als solches), das zugleich jahrhundertelang lebendige Weltdeutung war und in einem nichtreligiösen Sinn sogar heute noch ist – wie sähe ein lyrisches Sprechen von Mythen, im Mythos aus, das nicht bloß neo-bürgerlich brav und FAZ-abdrucksreif gleich für den nächsten Tag ist?
Der Name Michael Donhauser ist noch nicht gefallen, aber ich spreche natürlich auch von ihm. Nehmen wir Natur und Landschaft, da Donhauser – viel zu ausschließlich, denke ich, als Naturdichter, als Poet der Landschaft, ja sogar einer bestimmten Landschaft apostrophiert wird. Nehmen wir die Religion, die als Existenzdeutung bis in Abstufungen so dominant war, war, aber in bestimmten Haltungen und Vokabeln, vielleicht kurz aufblitzenden Stimmungen in Spuren noch ist. Und benennen wir den Mythos, der nicht mehr über Götternamen, über Halbgötter und Sagenheroen, bei Donhauser anwesend ist, aber vertrackt-versteckt eben doch: Ist nicht Landschaft, sind nicht bestimmte Landschaften, in ihrer Pracht und Übermächtigkeit und – an einigen Stellen wenigstens – Überzeitlichkeit etwas Mythisches, in das eingelassen zu sein durchaus als Glück erfahren wird? Schreibt sich von daher auch die sprachliche Nähe mancher Gedichtstellen, manchen Gedichttons bei Michael Donhauser: Bringt alemannische Landschaft nicht absolut, aber historisch gesehen eine Sprache hervor, legt ihre Erfahrung eine Sprache nahe, die nicht ohne Grund überzeitlich ähnlich ist, und also gewissermaßen ihr fundamentum in re hat? Und was die Nichtvorgegebenheit von lyrischen Formen angeht, die nun in jedem Gedicht, für jedes Gedicht neu erfunden, gefunden werden muß, da keine Poetik und Ästhetik vordem Gedicht schon festliegt: Rührt von solcher Offenheit der Formen die Vielfalt der Gedicht- und Textverläufe, die Michael Donhauser manchmal in naher Anlehnung, meist als entferntes Echo von Texttypen, Sprechweisen, Zeilenorganisation von Autoren wie Rimbaud, Trakl, Rilke, aber auch Francis Ponge erkundet, sich anschmiegt, um sich dann wieder leicht davon abzustoßen? Sie sind aber bei Donhauser so flüchtig, so punktuell, so diskret anwesend, daß fast schon die Namensnennung von poetischen Vätern, poetischen Verwandten zu eindeutig, zu massiv wirkt. Direkt zitiert wird hier ja ohnehin nur in Halbsätzen oder als Halbsätze.
Sicherlich eines der stabilsten Kennzeichen von Michael Donhausers Texten und eine herausragende Erfahrung für den jetzigen Leser seiner Gedichte, Prosagedichte (wenn man so will) und Haiku-ähnlichen Dreizeiler, seiner Elegien und seiner Langenverse ist dann wohl doch seine Zuwendung zur Natur und zur Landschaft. Aber solche Zuwendung zum Gegenüber Natur und solches Aufrufen von Landschaft, speziell der eigenen heimatlichen Landschaft, ist ja nichts Zeitloses, sondern hat jeweils Stellenwert, geschieht in einem Determinantenfeld von persönlichen und überpersönlichen Gründen und ist eine produktive Herausforderung: etwas zu benennen und zu feiern, was bis vor kurzem kein Sujet (mehr) war und wofür es vielleicht keine Sprache mehr gibt. Bei Donhauser darf man das vielleicht auch lesen als einen Versuch, sich von einer zu nichts verpflichtenden Internationalität und Überregionalität unpolemisch aber entschieden abzuwenden und ein Sprechen über Natur, Heimat, Landschaft zu entwickeln just zu dem Zeitpunkt, da dies als zu erfahrendes Gegenüber im Verschwinden oder doch in Reduktion begriffen ist. Regionalismus oder Anti-Intellektualität kann man Donhauser ja ohnehin nicht vorwerfen, also ist sein Bekenntnis zum in der Region verwurzelten Gedicht gegen eine politisch korrekte Überregionalität und natürlich, natürlich! – europäische Weite zu wünschender Gedichte auch als zarte Dickköpfigkeit zu verstehen: „Ein Gedicht“, so schrieb er vor sieben Jahren, sei nicht zuletzt auch „von der Möglichkeit und Bereitschaft abhängig, sich einer Region anzuvertrauen, den Garten zu pflegen, unseren“. Wenn alle von der Internationalität der heutigen lyrischen Sprache schwärmen, dann will er doch gleich einmal die Großregion kleinteilig-konkreter machen, und so schreibt er im selben Text zum sogenannten ,Europäischen Gedicht‘: „Poesie ist regional, bezieht ihre Kraft aus dem terroir, der Erde, Lage und ihrer Beschaffenheit, den biologischen und energetischen Vorgaben… – ein europäisches Gedicht gibt es insofern nicht, als es kein europäisches terroir als einheitliches gibt…“ Im Zeitalter der Europäisierung, ganz zu schweigen von einer Globalisierung, in der alles Angloamerikanische zum akklamierten Standard der einen durchkolonialisierten Lebenswelt wird, spricht Donhauser von und aus Enklaven der Verstädterung, von kleinen erhaltenen Flecken und Momenten aus, die noch nicht konsumindustriell imprägniert und applaniert sind; Natur und Landschaft werden zum Gegenüber im Augenblick ihres wahrscheinlichen baldigen Verschwindens; sie werden nicht glorifizierend, sondern eher melancholisch feiernd angeredet und angesprochen.
„Die ganze Poesie“, sagt Michael Donhauser, „beruht darauf, daß man Gesang und Wein als himmlisches Feuer sinnvoll ineins setzen kann“, mir eine der schlagend-schönsten hölderlinisch gedachten Definitionen von Poesie, mit der zusätzlichen ironischen Volte, daß Michael Donhauser nun von dieser Möglichkeit bedeutsamen Sprechens, bei dem eines symbolisch ein anderes meint, wenig Gebrauch macht, erneut ein Signum dessen, wie bedenklich es steht um unfraglich-affinnatives metaphorisches Sprechen. Er selbst, muß man sagen, ist da vorsichtig; eigentlich ist er eher ein Benenner als ein Vergleicher und Gleichsetzer, er schaut an und benennt und schafft ein Bild, Bilder, weniger Metaphern. Und er vertraut bei Abstinenz von Metaphorizität darauf, daß Gegenstände als Bilder dringlich intensiv und suggestiv genug sind. Man kann fast sagen: Er geht bescheiden vor, er benennt – bis hin zu bisweilen fast ganz ausgenüchtertem Erzählen, etwa in den meisterlichen Prosastücken der 17 Diptychen – und will so das pure Benennen übersteigen in Richtung ,Poesie‘, in Richtung Rückgewinnung von Magie, die beim Prozeß der Entzauberung der Welt verloren ging. Man kann ja große Teile der Dichtung des 20. Jahrhunderts und gerade auch die Poesie der Avantgarde verstehen als Versuche der Rückgewinnung magischen, auratischen Sprechens nach dem Verlust der verläßlichen alten Sprachmagie – die Heilige Gertrude Stein und die Konkreten Poeten sind unsere Zeugen für eine solche Poesie ohne Metaphernzauber. Manchmal habe ich den Eindruck, daß Michael Donhauser intensivst hofft, daß die Dinge, die er einfach intensiv zu sehen und zu benennen, zu bannen versucht, ebenso innig und intim zurückblicken, aber er ist sich nicht großspurig sicher, daß sie so „bedeutend“ sich verhalten werden, und er will sie seinerseits nicht willkürlich mit Bedeutung begaben; fast ist ihm sein frühes, früheres feierndes Loben großer Anblicke in Alemannien und am Oberrhein schon zu weit gegangen, war fast zu hymnisch vertrauensselig, und daher wurde das ausgenüchtert zu der ruhigen Aufmerksamkeit, mit der der einsame Spaziergänger durch ein Mittelmeerhafenstädtchen oder durch Tübingen oder auch durch Pariser Gärten und Parks sich bewegt und dem ruhigen Notat nur noch ganz selten einen Aufschwung hölderlinischer Feierlichkeit oder einen Moment der Bedeutsamkeit durch die geliebte „Amsel“ als Inbegriff des sowohl Natürlich-Einfachen wie des Poetischen erlaubt.
Natur und Landschaft, Dorf, Park und Garten, auch Vorstädte: Donhauser ist sich nicht sicher, daß im stillstehenden Gegenüber von Betrachter und Gegenstand auf den Moment wunderbarer Verschmelzung gewartet werden könne; auf diesen Moment des entgrenzenden Einklangs setzt er nicht, das wäre ,Stimmung‘, würde heute wie forcierte ,Unio‘ wirken, oder naiv. Es bleibt bei Donhauser immer eine haarfeine Distanz zu den Objekten; ,Stimmung‘ wird durch leise, fast dröge Sachlichkeit unterlaufen, in Schach gehalten durch großäugige und gleichschwebende Aufmerksamkeit. Der Betrachter bei Donhauser steht nicht, sondern geht, er steht nicht auf einem ,vantage point‘, sondern nimmt in langsam-längerem, gestrecktem Schauen auf, addiert sorgsam Gesehenes und wartet, und er wartet nicht auf punktuelle offenbares Zünden im Subjekt.
Stimmung, Verschmelzung von Innen und Draußen, das wäre die eine, utopische, doch abgewehrte Möglichkeit; die andere heißt oder hieße naheliegenderweise „Idylle“, die stillgestellte, unbewegliche Glückserfahrung, doch der mißtraut der Wandernde, der lieber registriert, als daß er auf den vollendeten Moment wartet, wie er ja auch das Glück von Naturwahrnehmung und Landschaft eben nicht zur „Idylle“ arrangiert sehen will und das einst noch mögliche Lob der Schöpfung sich quasi verkneift: „zögern“, Aufschub vorbehaltlosen Glücks, nüchterner wie frommer Skrupel ist ein wichtiges Verb und Element von Michael Donhausers Dichtung: „alles Sagen / war ein Sehen / war ein Zögern …“ – diese unauffällige Stelle spricht von einem wichtigen Element seiner Poetik und seiner selbst, fast könnte man sagen: seiner Religiosität. In seiner Rede auf drei Gedichte von Christian Wagner benannte Donhauser vor drei Jahren sein diffiziles Reagieren auf die Gattung und den Geist der Idylle, die ihm, bei allem Lob auf die Schöpfung, das man sich als eine große Emotion aus der Vergangenheit noch emphatisch vorstellen kann, schon eine Schrumpfform von Religiosität zu sein scheint und also auch seine Emphase in Richtung Nüchternheit dämpft: „Was die Idylle betrifft, so bleibt mein Verhältnis zu ihr stets ein zwiespältiges, denn es wohnen in ihr Kräfte, welche sich unbehaust verlieren würden: die Idylle ist ein Bildchen, welches den Verlust beherbergt, der Bilder, die in einem religiösen Sinn Heimat waren …“ – ungebrochen idyllisch zu sprechen, auch und gerade als Naturlyriker, wäre der emphatische Einsatz von Ersatz für etwas, das schon im 18. Jahrhundert Religionsersatz war. So kann Einklang mit einem Moment in Landschaft und Natur nur in einer Art gehobener Fröhlichkeit angesprochen werden – mehr gibt uns unsere bis ins Innerste reichende Skepsis und Entzauberung nicht her, mehr wäre poetisch erschlichen und stimmungshaftes Talmi:
Wie ich dann, einmal, später, nach einer Zugfahrt durch die Nacht zurück zu den Hügeln kam, in die Stadt, die den Hügeln zu Füssen lag, ging ich abends von der Endstation einer Strassenbahn hinauf durch ein Tal und zu dem Gastgarten, wo ich wieder umgeben von Forsythien war und von der Fliederhecke, der verblühten, während ich unter einem Kastanienbaum sass – am Weg schon hatte das Gebüsch oft blütenreich geduftet, und wie war ich da wieder aufgehoben in der Milde, in dem Sanftwilden als Fülle und Duft, dass ich träumte, grüsste den Traum, der fremd mir geworden war, das Nahe als die Tische und als Bänke, als Laternen, die dann glimmten und leuchteten schon, wie das Licht noch mit einem letzten Scheinen durchwirkte die kühlere Luft, bis dann vom Himmel die Tiefe der Nacht in den Gastgarten sank
Das ist nun wirklich – um auf Gottfried Benns so sympathische wie martialische Dikta zurückzukommen – weder „unbarmherzig“ noch ein „Faustschlag“, aber es ist riskant und einmalig eigensinnig, es ist dezidiert im Nicht-Modischen, und es ist an ihm zu loben, was an jedem Poeten zu loben ist, wenn er wirklich einer ist und was Lessing in der Fabel vom Phoenix am Phoenix lobte: Er ist der einzige seiner Art. Dies zu schätzen zu wissen, ist einer Minorität von Lesern vorbehalten, aber wie es mit Minderheiten so ist – was wir hiermit so bekräftigen wie 1968, als wir es allerdings noch etwas anders meinten: „Wir – sind eine – kleine – radikale – Minderheit!“ Nämlich die Leser von Lyrik, zu deren Glücksmöglichkeiten es gehört, wahrzunehmen, wenn sich Gedichte wie die Michael Donhausers und der anderen hier anwesenden Dichterinnen und Dichter Mündern entzüngeln.
Zwei Fragen am Schluß: Erstens: Wo bleibt die erzählende Prosa Michael Donhausers? Antwort: Man kann nicht über alles reden. Und zweitens: Wo ist hier Ernst Jandl? Wenn bei Jandl ein Baum vorkommt, dann heißt er natürlich „Der künstliche Baum“ und gehört mit aller Abstraktheit doch ins Großstädtische, auch wenn darüber oder davon bei Jandl gar nicht die Rede ist: Abstraktion ist großstädtisch. Die Jandlsche Sprechweise ist bei aller Differenziertheit, aller Nuancierung doch immer massiv und heftig, sie ist existentiell (etwas, das wir an Ernst Jandl immer mehr wahrzunehmen lernen), rücksichtslos und drastisch (bisweilen in einer Art drastisch, daß es Friederike Mayröcker manchmal schon gar nicht gefallen hat). Und das ist eine ganz andere Ästhetik als die Ästhetik der Texte Michael Donhausers, die auf Mittelbarkeit und Diskretion, auf Andeutung und vorsichtige, zögernde Benennung eher setzt als auf wortspielerisches, notfalls auch ziemlich kurz angebundenes Umspringen mit Gegenständen.
Was aber auch diese weit voneinander entfernten Œuvres miteinander eint, das ist die Entschiedenheit, die der modischen, von Mehrheitswünschen und -erwartungen nicht erreichbaren und unter Einreden nicht wankenden Entschlossenheit entspringt, ,sein Ding‘ zu verfolgen, seine Sprache zu sprechen, an seinen Punkt unbeirrbar gebannt zu bleiben. Die Härte und Auffälligkeit Ernst Jandls ist nicht Michael Donhausers Sache, muß es aber historisch vielleicht gar nicht sein, weil eben die Entfesselung des Sprechens mit und in allen Registern von Sprache und Wirklichkeitswahrnehmung schon von Jandl und seiner Generation geleistet wurde. Aber, um ein zeitlich entlegenes Beispiel zu zitieren, der Rückgriff auf älteres Englisch am Ende des 16. Jahrhunderts etwa in Edmund Spensers Fairie Queen war auch nicht rückschrittlich, sondern zu dem Zeitpunkt als Aktivierung vergangener Sprache, als Rückgriff auf ein vergangenes Stilregister poetisch progressiv, fast hätte ich gesagt: kreativ. Einsam der Natur gegenüberzutreten und zu sprechen zu versuchen, tasten nach der Sprache, die da noch oder wieder möglich wäre – das ist die unauffällige Radikalität Michael Donhausers.
Jörg Drews: „Laudatio auf Michael Donhauser“. In: manuskripte. 2005. H.169. S.84–87.