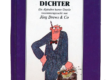Jörg Drews: Nachwort. Zu "Günter Eich. Sämtliche Gedichte"
Vielen Lesern dürfte Günter Eich als Lyriker nur durch zwei Gedichte und eine Gedichtzeile gegenwärtig sein – er, der doch neben Benn, Krolow und Celan in den fünfziger und sechziger Jahren einer der bekanntesten und geschätztesten Lyriker nach dem Zweiten Weltkrieg war. Anthologien und Literaturgeschichten tradieren ihn vor allem als den Autor, der – neben einem Dutzend Hörspiele und den Prosagedichten Maulwürfe und Ein Tibeter in meinem Büro von 1965 und 1970 – zwei der für die Stunde der totalen Verarmung und Entblößung Deutschlands im Jahre 1945 aussagekräftigsten Gedichte, Inventur und Latrine, geschrieben und der eine äußerst einprägsame und vielzitierte lyrische Warnzeile ans Ende seines bekanntesten Hörspiels Träume gesetzt hat: „Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt!“ Eine solche Reduktion seiner Bekanntheit auf weniges allzu Vertraute aber tut Günter Eichs Werk Unrecht, einem Werk, das von 1945 bis 1970 – vor allem und gerade in der Lyrik – immer größere Melancholie angesichts des Weltzustandes mit einer strengen, kargen Grazie verband, das Spott und Lakonie in vielfältiger Weise amalgamierte und das der vordergründigen Opulenz der Gedanken und Bilder (wie sie in der Lyrik der fünfziger Jahre gar nicht so selten war) mit Witz und Hintersinn sarkastisch-trocken begegnete.
Eichs leise Strenge, die seine Gedichte in den letzten Lebensjahren zunehmend prägte, ist eine relativ späte Errungenschaft nach Jahren stilistischer Unsicherheit und Anlehnung an andere Autoren. Die Verse des schmalen Bandes Gedichte, mit dem er 1930 debütierte, sowie selbst noch viele der Gedichte, die er in die Sammlung Abgelegene Gehöfte von 1948 aufnahm, bedachte er später mit großem Spott – und das war keine Koketterie. Diese Verse durchweht ein Hauch von Rilkes lyrischer Sprache, sie lehnen sich an Gottfried Benns frühe und mittlere Lyrik, ohne doch Rilkes hohen seraphischen Ton oder Benns intellektuelle Spannung zu erreichen. Viele dieser frühen Gedichte sind zerlaufen, unsicher und redselig, haben in manchen Fällen Strophe und Reim bisweilen schon deshalb nötig, um überhaupt eine Form zu zeigen; sie feiern Naturmystik und zelebrieren Großstadtferne mit einer postexpressionistischen Rhetorik, die zumindest uns heutigen Lesern – die wir die späten zwanziger Jahre im Lichte Bertolt Brechts, Kurt Tucholskys und Walter Benjamins zu sehen gewohnt sind und kaum mehr im Lichte Wilhelm Lehmanns oder Oskar Loerkes – seltsam und bis zum Gespenstischen spannungslos vorkommt. Eichs damaliger Wunsch, vom Intellekt „unbeschwert“, nur „eine Mücke, ein Windstoß, eine Lilie“ zu sein, wie es im Gedicht Verse an vielen Abenden heißt, hat eben nicht die antizerebrale Wucht der Bennschen Gesänge und ihrer regressiven Sehnsucht danach, ein „Klümpchen Schleim in einem warmen Moor“ zu werden.
Dann aber, in den dreißiger und vierziger Jahren, beginnt sich Eich aus der fatalen Harmlosigkeit von Bratapfellied und Loblied auf eine Petroleumlampe hervorzuarbeiten; er läßt die Vagheiten und klagenden Fragen hinter sich, die da lauten: „daß alles fraglich wird und voll Gefahr“ oder „Wie begegne ich nun“ oder auch: „Vergangenes fällt wie braunes Laub und Wind“, Verse, gespickt mit „manchmal“ und „irgendwann“ und auslaufend in die Beteuerung, „daß ganz inwendig / noch etwas ist, was weint“. Man hat den Eindruck, daß die Hörstücke und Hörfolgen rustikal-idyllisierender Art, (zum Teil zusammen mit Martin Raschke) verfaßt für den Deutschlandsender, den Reichssender Berlin und andere Stationen, mit denen Eich in den dreißiger Jahren sein Geld verdiente und die ihm selbst zunehmend tiefes Unbehagen bereiteten, seine Entwicklung auch als Lyriker gehemmt haben; „des Frühlings heiterer Brief“, „des Waldes kühler Segen“, „des Waldes hellstes Kind“ – das ist im spätromantischen Volkston gesprochen, in einem allerdings künstlichen Volksliedton vor dem Hintergrund einer Moderne-Verweigerung, wie sie von Rudolf Borchardt bis Hermann Hesse – unter den verschiedensten politischen und ästhetischen Vorzeichen – im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts neben den literaturrevolutionären Bestrebungen ja eben auch zu beobachten ist. Noch in den von Günter Eich 1945 zusammengestellten Notizblättern finden sich Gedichte, die unsere Zweifel daran zu nähren geeignet sind, daß mit dem Jahr 1945, und dem damit benannten katastrophalen Epochenbruch, nun wirklich eine „Stunde Null“ auch in der deutschen Literatur gegeben war. Auch bei Eich wurden neue Darstellungsmittel erst erarbeitet, in einem allmählichen Prozeß der Modernisierung des Ausdrucks, geprägt von Zweifeln und mühseligem Tasten. Und auch dieser Prozeß blieb nicht ohne Rückschläge, ohne Phasen ästhetisch reaktionärer und verharmlosender Sehnsüchte, wie das Abendgedicht (zunächst Abend am Zaun überschrieben) zeigt:
Am Abend duftet holder die Kamille
vom Feldrain her. Der Posten bläst
auf seiner Okarina. Gottes Wille
im Glanz des Abendsternes sich vollzieht.
Wie viele doch sind nun für immer stille,
die gerne sich erfreut an Stern und Lied!
Nun sind sie selbst darin und Gottes Wille
in Glanz und Duft und solcher Abendstille
geschieht.
Entstanden ist dieses Gedicht wahrscheinlich 1945, und es verschlägt einem denn doch die Sprache, wenn man liest, wie rasch getröstet sich hier einer Gottes Willen unterstellt und diesem die Millionen Toten anbefiehlt, die nun zwar wahrhaftig „für immer stille“ sind, aber gemäß dem Willen des Dichters in „Glanz und Duft“ der „Abendstille“ im höheren Sinne als „aufgehoben“ zu betrachten seien. Europa ein Schlachtfeld, ein verwüsteter Kontinent, aber die Kamille duftet hold wie immer.
Zugleich jedoch zeigt sich, wenngleich unruhig-flackernd und eher flüchtig, in den Gedichten aus der Soldatenzeit und aus dem Gefangenenlager schon die Gestörtheit der Weltordnung, die – wenngleich immer noch ordentlich gereimte – Ungereimtheit der Welt:
Ungerührt von allem besteht
die Unvollkommenheit der Welt.
Gottes eisiger Odem weht
übers Gefangenenzelt.
Von hier aus führt eine direkte Linie zum resignativen Stoizismus des alten Eich. „Vergänglichkeit, das ist, was ich glaub“, heißt es bereits in der Sinziger Nacht von 1945, und aus diesem Geist stammt auch die neusachliche Trockenheit des unterschwellig aggressiven, zugleich aber heiter-unpoetischen und diesseitsorientierten Gedichtes Pfannkuchenrezept, in dem der Dichter die lyrische Überhöhung alten Stils aus der Erfahrung des materiellen Mangels heraus glatt verweigert:
Die Trockenmilch der Firma Harrison Brothers, Chikago,
das Eipulver von Walkers, Merrymaker & Co, Kingstown, Alabama,
das von der deutschen Campführung nicht unterschlagene Mehl
und die Zuckerration von drei Tagen
ergeben, gemischt mit dem gut gechlorten Wasser des Altvaters Rhein,
einen schönen Pfannkuchenteig.
Man brate ihn in der Schmalzportion für acht Mann
auf dem Deckel einer Konservenbüchse und über dem Feuer
von lange gedörrtem Gras.
Wenn ihr ihn dann gemeinsam verzehrt,
jeder sein Achtel,
oh dann spürt ihr, wenn er auf der Zunge zergeht,
in einer üppigen Sekunde das Glück der geborgenen Kindheit,
wo ihr in die Küche euch schlichet, ein Stück
Teig zu erbetteln in der Vorweihnachtszeit,
oder ein Stück Waffel, weil Besuch gekommen war am Sonntagnachmittag,
spürt ihr in der schnell vergangenen Sekunde allen
Kuchenduft der Kinderjahre, habt noch einmal
fest gepackt den Schürzenzipfel der Mutter,
oh Ofenwärme, Mutterwärme, – bis ihr
wieder erwacht und die Hände leer sind
und ihr euch hungrig anseht und wieder
mürrisch zurückgeht ins Erdloch. Der Kuchen
war auch nicht richtig geteilt gewesen und immer
muß man aufpassen, daß man nicht zu kurz kommt.
Das Gedicht steht ganz vereinzelt unter den Gedichten der Jahre nach 1945; es macht ernst mit Alltag und Vergänglichem als Material, es streift zwar die Sentimentalität, oder besser: das Sentiment, gleitet aber nicht darin ab und endet in einem (aus knurrendem Bauch) knurrigen, doch weltzugewandten Realismus. Eichs Gedichte aus den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren sind Zeugnisse einer lyrischen Stilmischung, die sich unterschiedlichster Elemente von der Naturlyrik der Dichtergruppe um die Zeitschrift „Die Kolonne“ (der Eich um 1930 angehörte) bis hin zu Brechtischer Nüchternheit bedient. Sie reicht von den fast zaghaften Lyrismen der bei Eich häufig vorkommenden kurzen Verszeilen (mit nur zwei oder drei Hebungen) vieler Gedichte, die zart und zurückhaltend (im schlechteren Fall auch kurzatmig) klingen, bis hin zu Versuchen, mit den verbrauchten Mitteln lyrischer Metaphorik sogar die Entwicklungen der Kriegstechnik sprachlich zu fassen. So heißt es in der zweiten Strophe des Gedichts Erwachendes Lager:
Geweckt vom Lärm in den Lüften
der donnernden Engel aus Erz,
heben sich in den Grüften
die Augen himmelwärts.
Die „Grüfte“: das sind die Erdlöcher, in denen der Kriegsgefangene Eich bei Remagen zusammen mit Tausenden anderer ein paar Wochen im Frühjahr 1945 verbringen mußte. Daß man sich in diesem Einzelgrab schon wie eine Leiche in der Gruft gefühlt hat, mag plausibel sein, aber die B-17-Bomber zu „donnernden Engel(n) aus Erz“ zu poetisieren, ist problematisch. Jedenfalls beginnt Eich hier mit einer zweiten poetischen Vermessung der Welt, sucht neue ,,trigonometrische Punkte“ für die Kartierung dieser Welt im Gedicht; erst hier, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, setzt jener Bogen an, den die Entwicklung seiner Lyrik bis zu seinem Tod im Jahr 1972 mit großer innerer Logik beschreiben wird.
Es ist, als sei es Eich dabei unwohl gewesen, von Metaphern oder gar von Symbolen in seiner Lyrik zu sprechen; von ihm selbst und von seinen Interpreten nicht ohne Grund bevorzugt wurde der Begriff der „Chiffre“, der vorsichtiger ist als der des „Symbols“, nicht so prätentiös, offener, auch individueller. Gerade Eichs Gedichte aus den fünfziger und frühen sechziger Jahren sprechen vor allem davon, wie ihm die Welt voller „Zeichen“ war, voller Dinge und Dingkonstellationen, die etwas besagen wollten oder könnten, wenn man nur offener dafür wäre, wenn man ihre Botschaft deuten könnte, ohne sie in spruchartige Weisheiten zu überführen, wenn man sich von ihnen in ein Geheimnis jenseits rationaler und glatter Beschreibungen mitnehmen ließe. Zu jenem Zeitpunkt, vor allem in den Gedichten des Bandes Botschaften des Regens, scheint Eich zuversichtlich, die Wirklichkeit sei in solchen Zeichen lesbar und – geradezu im romantischen Sinn – über „Zauberworte“ erreichbar.
Allerdings werden damals auch jene Gedichte zahlreicher, in denen sich Eich buchstäblich keinen Reim mehr zu machen vermag auf die Welt, weil sie ihm im emphatischen Sinn ungereimt vorkommt. Regelmäßige Vers- und Strophenmaße werden seltener; ernüchterndes Zersplittern von Zusammenhängen oder spöttisch-prosaisches Benennen von Nicht-Zusammenhängen nehmen zu; das magische, auratische Sprechen ist erschöpft. Solch schwindendes Einverständnis mit der Welt zeigt sich schon früh in Gedichtspuren wie „Manchmal glaube ich noch die Welt zu halten, / wo sie rings schon auseinanderfällt“ (Ausfahrender Zug, 1947). Dieses bittere Pathos vertieft sich über die Jahre hinweg, bedingt nicht zuletzt durch die Wahrnehmung, daß die Geschichte als Geschichte von Macht und Gewalt mit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu Ende ist, sondern sich offenbar nach denselben Prinzipien weiterbewegt – Kalter Krieg, Wiederaufrüstung und Atomkriegsgefahr sind die zugehörigen Erfahrungen – und kommendes erneutes Unheil sich voraussagen läßt. Logik und Rationalität sind Werkzeuge von Machtausübung, Vernunft ist leicht verwandelbar in instrumentelle Vernunft. Dagegen gab es für Eich nur die bald resignierte, bald aggressive Hinwendung zu Anarchie und „Nichtmehreinverstandensein“, ein Sichverweigern und eine Lakonie im Sprechen bis an die Grenze des völligen Verstummens. Die Zuversicht, aus den sich darbietenden Dingen ein Geheimnis „entziffern“ zu können, ausgeprägt in Gedichten wie Die Totentrompete oder Die Häherfeder, wird langsam ausgehöhlt oder wendet sich in düstere Prophetie; die Chiffre wird zum Omen, in historisch-politischer Hinsicht auch zur Drohung.
„Ich will in solchen Schriften lesen. / Was schrieb das Gras, was schrieb das Meer?“ Die entschlossene Suche nach dem Zauberwort, das man einst zu kennen geglaubt hat, „allen Wörtern unähnlich und gemeinsam“, dem Wort, „das wie Sesam die Türen der Berge öffnet“, hat sich für Eich also erledigt. An die Stelle des poetisch organisierten und poetisch dechiffrierbaren Weltganzen tritt ein verdunkeltes Weltbild, auf das sich einzig noch mit tiefem Pessimismus und völliger Resignation antworten läßt, mit bösem, kaum je heiterem Nonsens und immer kürzer werdenden Aussagen. Besaßen Strophe und Reim in seinen früheren Gedichten selbst bei melancholischen Botschaften noch Elemente des Entschärfenden und Versöhnlichen, so treibt Eich den Gedichten in freien Rhythmen, besser: den Gedichten aus Prosasätzen, die Poetizität soweit wie möglich aus und läßt einzig die prophetische Chiffre für Unheil und Bedrohung bestehen:
Betrachtet die Fingerspitzen! Wenn sie sich schwarz färben,
ist es zu spät.
Diese Reduktion verschärft er bis zur zärtlich-komischen Kahlheit der Formeln, die er gleichsam in zwei Raten liefert: am Ende von Zu den Akten (1964) und zwei Jahre später in Anlässe und Steingärten. Es sind diese Gebilde in ihrer verblüffenden Dichte und mit ihrem zwischen Hohn, Rätsel und Kalauer irisierenden Ton die lyrischen Gegenstücke zu seinen Maulwürfen. In ihnen ist das lyrische, aller verbindlichen Ausführlichkeit sich total verweigernde Gegenstück zu den diversen physikalischen „Weltformeln“ zu erkennen, die im 20. Jahrhundert von Einstein bis Heisenberg aufgestellt und gerade in den 60er Jahren von der Presse wieder eingehend diskutiert wurden. Eichs sarkastische Repliken sind so etwas wie wortkarge Zauberformeln, hinter denen nur noch Schweigen liegen und auf die nur noch völliges Verstummen folgen kann.
Untergründig scheint aber noch etwas anderes in den Gedichten der Nachkriegszeit und dann wieder der sechziger Jahre zu wühlen und Eich unablässig zu beunruhigen, etwas, das zur depressiv anmutenden Wortkargheit der späten Gedichte zumindest beigetragen haben mag. Es ist dies der Gedanke an die Opfer der Nazi-Diktatur in den dreißiger und vierziger Jahren, an die, welche umkamen, verschwanden, ermordet wurden, während man selbst noch vergleichsweise glimpflich davonkam. Nachdem Eich die Opfer von Unterdrückung und Weltkrieg, aus der konventionellen Denkfigur heraus, daß niemand aus Gottes Hand falle, der Fiktion eines göttlichen Willens unterstellt hatte, erschien ihm dieser Beschwichtigungsversuch nach und nach als ungenügend und wohl auch als beschämend. In dem Eröffnungsgedicht Abendliches Fuhrwerk des Bandes Abgelegene Gehöfte, das wahrscheinlich Ende 1945 / Anfang 1946 entstanden ist, lautet die dritte Strophe:
Etwas streift mir die Schläfe
auf meinem erhöhten Sitz.
Noch andere Schritte gehen
im Klappern des Pferdeschritts.
Was die Schläfe des in dem Gedicht Sprechenden „streift“, das Gefühl oder die Erinnerung an „andere“, die einst mit ihm – an seiner Seite, auf oder neben dem Pferdewagen – gegangen sind, ist wohl auch Erinnerung an jene Gruppe von Menschen – einen Teil des Opferkollektivs –, die mit den „vielen“ benannt wird in dem Gedicht Abend am Zaun. Diese „vielen“ hängen unlösbar zusammen mit den „Botschaften des Vorwurfs“, die einer zu hören und beantworten zu müssen glaubt und denen er nicht entgeht, auch wenn er weit wegreist:
Geh weit genug, ihm zu entgehen,
fahre zu Schiff oder suche die Wildnis auf:
Die Klapper des Aussätzigen verstummt nicht.
Du nimmst sie mit, wenn er zurückbleibt.
Horch, wie das Trommelfell klopft
vom eigenen Herzschlag!
Die Warnungen, die Beunruhigungen, von denen da die Rede ist, kommen nicht von außen, sie sind internalisiert: es ist Wissen, das sich aufs eigene Gedächtnis stützen kann. Die erinnerten Beunruhigungen kommen chiffriert zur Sprache in Wildwechsel, einem Gedicht zu Ehren von Nelly Sachs:
Schweigt still von den Jägern!
Ich habe an ihren Feuern gesessen,
ich verstand ihre Sprache.
Sie kennen die Welt von Anfang her
und zweifeln nicht an den Wäldern.
Zu ihren Antworten nickt man,
auch der Rauch ihres Feuers hat recht,
und geübt sind sie,
den Schrei nicht zu hören,
der die Ordnungen aufhebt.
Nein, wir wollen fremd sein
und erstaunen über den Tod,
die ungetrösteten Atemzüge sammeln,
quer durch die Fährten gehn
und an die Läufe der Flinten rühren.
Vom eigenen Mitläufertum im Dritten Reich ist hier die Rede, und auch wenn man es nicht so streng beurteilt, wie er selbst es – ohne sich je explizit dazu zu äußern – offenbar getan hat, so ist ihm doch seine Kumpanei mit den „Jägern“ eine seelische Belastung gewesen und Grund genug für den Appell, alles, was damit zusammenhängt, nicht zu verdrängen; es ist wohl kein Zufall, daß er gerade dieses Gedicht 1966 in eine Verlagsfestschrift für die jüdische Dichterin Nelly Sachs einrücken ließ. – Unter den ungedruckten Gedichten Eichs findet sich auch Alle Augenblicke. In ihm greift er drei Augenblicke seines Lebens im Krieg heraus, in denen er irgendetwas Banales oder Normales getan hat oder ihm etwas Unangenehmes wiederfahren ist – Nichtigkeiten im Vergleich zu dem, was etwa der Prager deutsch-jüdische Schriftsteller H. G. Adler in Theresienstadt und Auschwitz zur gleichen Zeit, sozusagen in parallelen Augenblicken, zu erleiden hatte:
In diesem Augenblick
spielte ich Schach in Wilmersdorf,
trank französischen Kognak und fand ihn seifig.
In diesem Augenblick
begann ich Schallplatten zu sammeln,
kam die Dienstreise nach Lemberg gelegen.
In diesem Augenblick
dachte ich an Salzstreuer der Berliner Manufaktur
und hatte Ärger mit dem Portier.
Im Gedicht selbst wird der Hintergrund, sozusagen der Grund dafür verschwiegen, daß dieses Gedicht über Berliner Augenblicke sich überhaupt konstituiert hat. Allenfalls über einen Kommentar ließe sich erschließen, was Eich bei der Lektüre von Adlers Büchern durch den Kopf gegangen sein mag: Was habe denn ich damals gemacht? Nun, er war Soldat gewesen, aber auf vergleichsweise harmlosem Posten – mit anderen Worten: Hier schämt sich einer dafür, daß er davongekommen ist, woraus ihm ja eigentlich kein Vorwurf zu machen wäre; aber man hat es zu akzeptieren, daß er selbst sich nicht ohne Schuld fühlte.
Es waren wohl diese allmählich gewonnenen Einsichten in die eigene historische Verstricktheit, es war die Wahrnehmung, daß Geschichte offenbar immer so gewesen ist und entsetzlicherweise auch immer so sein wird, die Eichs Lebensgefühl sich verdüstern ließen. Lyrik als „nachgestammeltes Naturgeheimnis“, eine von Eich zuerst respektvoll, dann skeptisch aufgenommene Goethesche Formulierung, hat er in den frühen sechziger Jahren hinter sich gelassen, sie „zu den Akten“ gelegt, indem er schneidend über sich selbst sagte: „Viele meiner Gedichte hätte ich mir sparen können, ich hätte jetzt ein Kapital …“ (Allerdings legte er nicht offen, waseigentlich ihn so sehr an seinen früheren Gedichten störte.) Geschichte und Politik (wenn auch nicht Tagespolitik) waren in sein Denken eingedrungen, und Entschuldigungen, auch seiner eigenen Verhaltensweisen, ließ er nun nicht mehr so leicht gelten. Als ihm bei einem Besuch im Senegal, also an den historischen Orten des Sklavenhandels im 18. und 19. Jahrhundert, die leider nicht mehr veränderbare „Geschichte“ als Entschuldigungsformel vor Augen trat, schrieb er:
Sklaveninsel
Geschichte gilt nicht,
wir wollen schuldig bleiben.
Wir wollen lange genug
durch die Tür hinausstarren
aufs Meer,
bis wir zu zittern beginnen:
Dort stoßen wir sie auf die Schiffe
und sie schreien.
Auch das ist kaum zu ,verstehen‘ ohne eine Erläuterung, die einem Leser zumindest zwei, drei Daten und Fakten an die Hand gibt. Aber wie schön, aufklärerisch, rücksichtsvoll können Gedichte noch sein, wenn einem Welt und Geschichte in einem grellen Gleichnis als „ein geköpfter Hahn, der über den Hof rennt“, grausam-bündig zusammenschießen? Das war, wenn überhaupt, nur noch mit äußerstem Stoizismus und fast wortlos hinzunehmen. Als der Literaturtheoretiker Walter Höllerer Mitte der sechziger Jahre für die Wiederbelebung des „Langen Gedichts“ plädierte, antwortete Günter Eich mit acht kurzen, längstens fünfzeiligen Gedichten und stellte sie, die doch, selbst zusammengenommen, noch kein solches ergeben, provokant unter die Gesamtüberschrift Lange Gedichte.Mit ähnlich subversivem Trotz pflanzte er ein kleines Epigramm in den Steingarten Ryoanji (bei Kyoto) und ließ dieses so lange wuchern, bis sich doch noch drei Seiten meditativer Lyrik ergaben, die er aber schneidend enden ließ mit Sätzen wie „unser Ort ist im freien Fall“ und „unseren Freunden mißlingt die Welt“.
Damals machte sich Eich keine Illusionen mehr darüber, daß er mit seiner so gar nicht mehr verbindlichen, sich einwärts krümmenden Sprechweise, mit mürrischer Knappheit nicht gerade attraktiv blieb für Leser; seine einzige, sich selbst verspottende Zuversicht war:
In Saloniki
weiß ich einen, der mich liest,
und in Bad Nauheim.
Das sind schon zwei.
Natürlich war das übertrieben pessimistisch, aber als Lyriker machte Günter Eich in den frühen siebziger Jahren tatsächlich keine Furore mehr; er gab nur noch ein schmales Lyrikbändchen an die Öffentlichkeit: Nach Seumes Papieren, aus eingestandener Sympathie mit dem extrem bescheiden und zurückgezogen lebenden, struppig-verwildert und mürrisch durch Leipzig streifenden Dichter Johann Gottfried Seume (1763-1810), der mit anderthalb Jahren eines „gichtigen Sterbens“ geschlagen war. (Am Rande bemerkt: 1780 Absolvent der Nicolai-Schule in Leipzig, wie 1926 dann Eich.) Wie Zusammenhänge und Weltmodelle inzwischen für Eich aussahen, machte er mit den in der damaligen westdeutschen Literaturkritik heftige Debatten auslösenden Prosatexten Maulwürfe und Ein Tibeter in meinem Büro deutlich, deren Poetik enge Verbindung hat zu dem surrealistischen Satz, poetisch bzw. wunderbar und überraschend, weil gänzlich unvorhersehbar, sei die Begegnung einer Nähmaschine mit einem Regenschirms auf dem Operationstisch. Sein eigenes „Weltmodell“ bestehe inzwischen aus „Luftblasen, Beleuchtung, / verworfenen Versen“, spottete Eich ganz nebenbei, und der einzige noch faßliche, aber ebenfalls natürlich (ent)täuschende Zusammenhang der Welt – das, was sie gewissermaßen „im Innersten zusammenhält“ – liege allein in der Kopula „und“, durch welche man bekanntlich alles mit allem verbinden kann:
Und
macht die Welt begreiflich:
Der Schlieffenplan
und
eine Klingelanlage für Scheintote.
Das liest sich wie ein Kürzest-Maulwurf und markiert den Übergang der späten enigmatischen Epigramme zu den nicht minder enigmatischen Maulwürfen: In beiden Textsorten ist die Welt in ihre Details zerbrochen, wird nur noch schwermütig, zugleich juxig und doch rücksichtslos zusammengehalten durch bedenkenlos additive Reihung, durch Unsinnslogik und durch Verknappungen, die Sätze vom Kalauer ununterscheidbar machen. Offenbar traf Eich der Verlust allen Glaubens und aller Transzendenz mit voller Wucht; ein emphatischer Begriff von Brüderlichkeit formulierte sich für ihn allenfalls noch in der Anrede „Du, mein Schatten“ für den in Hiroshima in eine Wand eingebrannten Umriß eines (in atomarer Hitze verdampften) Menschen; eine neue realistische Anthropologie hat – so der späte Eich – vor allem zu berücksichtigen, daß „Menschen“ Wesen sind, zu deren Grundbestimmungen eben auch die Möglichkeit zählt, zu diesem Zweck abgerichtete Hunde auf ihre Mitmenschen zu hetzen.
Solcherart waren die bitteren Einsichten, die Günter Eich immer unabweisbarer zu haben glaubte und die er lieber in rätselhaften Verkürzungen als in ,verständlichen‘ Explikationen niederlegte. Doch hat schon André Gide gesagt, daß alles, was man in der Literatur im Nu verstehe, keine Spuren hinterlasse. Unaufwendig, mit vergleichsweise geringen Mitteln, in der fast taciteischen Kürze seiner lyrischen Prosa, mit achselzuckendem Understatement hat Günter Eich beunruhigend durchschlagend formuliert, was mit einem Menschen geschieht, den die Melancholie visitiert hat und der es nicht mehr selbstverständlich findet, in der Welt zu sein – einem Menschen, der keine Trostgründe mehr anerkennen kann und als dessen Daseinsgefühl sich, mit den Worten Gottfried Benns, die „mythenalte Fremdheit zwischen Welt und Ich“ endlich eingestellt hat. „Gefirmt durch einen Backenstreich des Nichts“ sei er, läßt er seinen (Quasi-)Sprecher in dem Maulwurf Windschiefe Geraden sagen. Vielleicht hätte er gern komischere oder heiterere Gedichte geschrieben. „Findet ihr nicht auch, daß meine Gedichte immer trauriger werden? Immer kürzer, immer trauriger?“ fragte er Freunde voller Bedauern. Ja, Günter Eichs Gedichte wurden immer kürzer und immer trauriger, aber sie behielten ihre spröde Anmut sogar dann, wenn sie sich von ursprünglich 17 Zeilen auf einen Zweizeiler wie Panorama in Waterloo zusammenzogen:
Bleibt im Sandkasten, Kinder,
Wer gab euch preußische Bataillone?
Schwer verständliche Gedichte sind in der Regel wichtiger als harmlos schwermütige; sie entfalten ihre Bedeutung historisch, nach und nach, und wenn sie zunächst auch „unangetastet von Verstehen“ sind, ist ihre Chance doch größer, einen Reichtum an Bedeutung zu besitzen, den sie allmählich freisetzen können, selbst wenn sie, wie Günter Eichs Gedichte, nicht damit prunken. Darum werden sie nicht nur in Bad Nauheim und Thessaloniki gelesen und immer wieder gelesen werden.
Sommer 2006
Jörg Drews
Jörg Drews: Nachwort. In Jörg Drews (Hg.): Günter Eich. Sämtliche Gedichte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2006, S. 613-633.